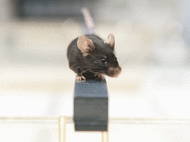Modellorganismus Maus
Wo es Menschen gibt, da sind auch Mäuse. Auf diese Formel lässt sich die Jahrtausende alte Beziehung zwischen Mensch und Maus bringen. Kaum ein Organismus hat so vom Menschen profitiert wie die Hausmaus (Mus musculus). Ursprünglich vom indischen Subkontinent stammend ist sie dem Menschen auf seinen Wanderungen einfach gefolgt und hat so nach und nach alle Kontinente erobert. Dieser Siegeszug ist vor allem der Entwicklung von Ackerbau, Vieh- und Pflanzenzucht zu verdanken, denn damit hat der Mensch den kleinen Nagern ganz neue Lebensräume eröffnet.
Jahrtausende lang als Schädling und Nahrungskonkurrent verfolgt interessierten sich im 18. und 19. Jahrhundert zunächst private Liebhaber und Züchter für die Maus. Diese züchteten Tiere mit unterschiedlichen Augen- und Fellfarben und tauschten ihre Schützlinge untereinander aus. Von der hohen Variabilität neugierig gemacht begannen im 19. Jahrhundert immer mehr Wissenschaftler, die Gründe dafür zu untersuchen und die von Georg Mendel entdeckten Erbregeln erstmals auf ein Säugetier zu übertragen.
Die Labormaus – ein Leben für die Forschung
Anfang des 20. Jahrhunderts legten Forscher dann den Fokus ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit der Maus stärker auf die Untersuchung von Krebs. Sie stellten damals fest, dass sie Tumore nur auf Mäuse mit einer bestimmten Mutation übertragen konnten. Tiere ohne diese Mutation stießen diese dagegen ab. Die Nachkommen verhielten sich dabei wie ihre Eltern, die Empfänglichkeit für Krebs war also offenbar angeboren.
Videos
Gehirne im Labor erzeugen: Wie weit darf Forschung gehen?
Gene, die in die Knochen fahren
Ein Quäntchen Gehirn
Wie viel Maus steckt im Menschen?
Für diese Forschung benötigten die Wissenschaftler daher Mäuse mit einem möglichst ähnlichen Erbgut. Es war deshalb ein Durchbruch, als Forscher 1909 erstmals Mäuse fortwährend untereinander verpaaren konnten. Die aus dieser Inzuchtlinie stammenden Tiere waren sich genetisch so ähnlich, dass genetische Unterschiede die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen nicht mehr verfälschen konnten.
1929 wurde dann in den USA das Jackson Laboratory zur Erforschung der Genetik von Säugetieren und Krebs gegründet. In der Folgezeit lernten Wissenschaftler immer mehr über das Erbgut der Maus: von der Zuordnung von Genen auf einzelne Chromosomen bis zur Entschlüsselung des genetischen Codes der Maus im Jahr 2002. So wissen wir inzwischen, dass die Maus rund 24.000 Gene besitzt und damit etwa genauso viele wie der Mensch. Bei der Maus sind diese Gene auf 40 Chromosomen verteilt, beim Menschen auf 46.
Heute ist die Maus das weltweit mit Abstand am häufigsten für Tierversuche eingesetzte Säugetier. Stand anfangs noch auf das Thema Krebs im Mittelpunkt, nutzen inzwischen Wissenschaftler nahezu aller biologischen Fachrichtungen die Maus als Modell. Bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Immunbiologie wären ohne die kleinen Nager nicht denkbar gewesen, wie zum Beispiel die Rolle von Antikörpern bei der Resistenz gegen Krankheitserreger oder das Prinzip der Immuntoleranz gegenüber körpereigenem Gewebe. Auch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Durchbrüchen in der Krebsforschung, die ohne die Maus nicht möglich gewesen wären, wurde mit Nobelpreisen gewürdigt.
Von der Hausmaus zur Labormaus

Die in der Wissenschaft eingesetzten Labormäuse stammen allesamt von der Hausmaus (Mus musculus) ab. Die Art lässt sich in drei Unterarten gliedern, zwei davon leben in Europa: Die westliche Hausmaus (Mus musculus domesticus) lebt westlich einer Linie, die durch die neuen Bundesländer, Bayern, das westliche Österreich und den Balkan zum Schwarzen Meer verläuft. Sie kommt auch in Afrika, Amerika und Australien vor. Die östliche Hausmaus (Mus musculus musculus) tritt östlich der Trennlinie durch Europa bis nach Japan auf. Die beiden Unterarten können sich zwar noch untereinander fortpflanzen, doch ihre Nachkommen sind weniger fruchtbar. In Südostasien ist zudem Mus musculus casteaneous beheimatet.
Die Labormaus ist ein Hybrid: Ihr Erbgut ist ein Mosaik aus allen drei Unterarten. Auf genetische Einheitlichkeit gezüchtet ist es weniger variantenreich als das der Wildmäuse, der Genpool der Labormäuse enthält also von den meisten Genen nur eine einzige Version. Manche Wissenschaftler halten die Unterschiede zwischen Wild- und Labormäusen inzwischen für so groß, dass sie die Labortiere als eigene Art ansehen und als Mus laboratorius bezeichnen.
Äußerlich können sich Mäuse aus Natur und Labor vor allem in der Fellfarbe unterscheiden. Bei der Wildform meist braun, haben Albino-Laborstämme weißes, andere Stämme schwarzes Fell. Während wilde Hausmäuse zwischen sieben und elf Zentimeter lang und 20 bis 25 Gramm schwer werden, schwanken Größe und Gewicht von Labormäusen je nach Stamm erheblich. Im Labor zeigen Labormäuse ähnliche Verhaltensweisen wie Wildtiere, sind aber deutlich ruhiger und weniger aggressiv.