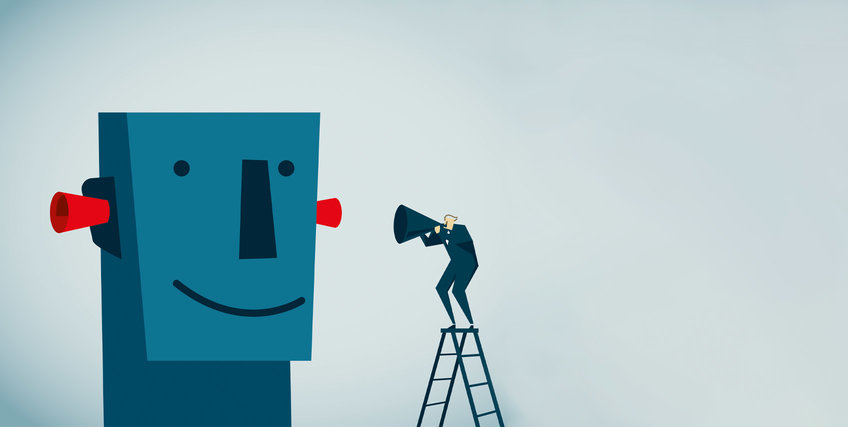Nichtwissen mit Bedacht
Bestimmte Fakten nicht zur Kenntnis zu nehmen, kann für den Einzelnen und die Gesellschaft eine gute Entscheidung sein
Manchmal ist Ignoranz eine Tugend. Ein bekanntes Beispiel sind Blindstudien in der Medizin, bei denen weder die Versuchspersonen noch die beteiligten Mediziner wissen, wer zur Experimental- und wer zur Kontrollgruppe gehört. So lässt sich ein Placeboeffekt ausschließen. Trotzdem war das Phänomen „gewolltes Nichtwissen“ – auf Englisch: deliberate ignorance – lange wenig beachtet. Zwei Max-Planck-Direktoren haben es in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Nun interessieren sich Forschende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen für diesen Ansatz.

Als James Watson, einer der Entdecker der DNA-Struktur, im Jahr 2007 sein eigenes Genom sequenzieren ließ, wollte er ein Teilergebnis auf keinen Fall erfahren: ein bestimmter genetischer Risikofaktor, der mit der Veranlagung für Alzheimer in Verbindung steht. Selbst ein so wissbegieriger Wissenschaftler wie Watson schreckte vor dieser Information zurück. – Mit diesem Beispiel beginnt der Aufsatz „Homo Ignorans: Deliberately Choosing not to know“, den Ralph Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und sein Kollege Christoph Engel vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern im Jahr 2016 veröffentlichten. Damit richteten der Psychologe und der Rechtswissenschaftler den Blick auf das Phänomen des gewollten Nichtwissens, das bis dahin selten untersucht wurde. Inzwischen sind ihnen zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Weg gefolgt. Die Spanne der beteiligten Disziplinen reicht von den Geschichts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften über die Soziologie und die Philosophie bis hin zu Biologie, Medizin und Informatik.
Das Überraschende am gewollten Nichtwissen ist, dass der Erwerb und die Schaffung von neuem Wissen in westlichen Gesellschaften eine tragende Säule der Kultur und der Wirtschafts- und Lebensweise sind. Es braucht also gewichtige Gründe, sich bewusst für Nichtwissen zu entscheiden. Der Fall von James Watson und seiner möglichen Veranlagung für Alzheimer ist dafür ein gutes Beispiel: Die Information wäre für Watson kaum von Nutzen, weil es nach wie vor keine wirkungsvolle Behandlung gegen die Krankheit gibt. Falls er erfahren hätte, dass er ein größeres Risiko für Alzheimer hat, hätte ihn das jedoch sehr wahrscheinlich psychisch belastet, die Nachteile waren also in seiner Einschätzung größer als die Vorteile.
Eine Abwägung von Kosten und Aufwand
In vielen Fällen, in denen deliberate ignorance zur Anwendung kommt, lässt sich die Wahl als Abwägung von Kosten – also dem Aufwand, den es braucht, eine Information zu gewinnen – und den möglichen Vor-und Nachteilen betrachten. Bei James Watson spielten die Kosten keine Rolle, er ließ sein Genom ja ohnehin sequenzieren. In anderen Fällen, gerade wenn es um medizinische Diagnostik geht, sind Kosten durchaus ein Argument: Schließlich könnte inzwischen potenziell jeder Mensch sein Genom analysieren lassen. Empfehlenswert ist das nach Meinung der meisten Fachleute jedoch nur, wenn es einen konkreten Verdacht auf eine erbliche Veranlagung für eine Erkrankung gibt – eine Analyse der kompletten DNA ist nach wie vor sehr teuer.
Zu den Kosten zählt nicht nur das benötigte Geld, sondern auch der Aufwand, an eine Information zu gelangen: Viele Menschen nutzen das Angebot medizinischer Vorsorgeuntersuchungen nicht, obwohl es hierzulande von den Krankenkassen bezahlt wird, weil sie den Aufwand scheuen, einen Arzt zu suchen, einen Termin zu vereinbaren, Zeit im Wartezimmer zu verbringen etc. Dazu kommt ebenfalls oft die Angst vor einem negativen Ausgang der Diagnose.
Auch die Frage, wann der Nutzen einer Information zum Tragen kommt, kann eine Rolle spielen. Wenn das Wissen erst in fernerer Zukunft relevant ist, wird es eher ignoriert – etwa im Fall von Rentenansprüchen in der fernen Zukunft.
Ausblenden als Gruppenentscheidung
Nicht nur Einzelpersonen können sich bewusst entscheiden, Wissen nicht haben zu wollen, auch in Gruppen zeigt sich dieses Phänomen. Denn Wissen betrifft selten nur eine einzelne Person. Eine Alzheimerveranlagung belastet nicht nur den Menschen, der sie attestiert bekommt, sondern auch den Ehepartner oder die Partnerin, seine Eltern und Kinder und den Freundeskreis. Die Entscheidung, Wissen darüber zu erhalten oder es zu ignorieren, wird oft gemeinsam getroffen. So beschließen werdende Eltern in der Regel zusammen, ob sie bei ihrem Kind Frühuntersuchungen etwa auf Trisomie 21 machen wollen oder nicht.
Ebenso praktizieren größere Organisationen wie Firmen, Behörden und Vereinigungen gewolltes Nichtwissen. Ein häufig genanntes Beispiel sind Berufsorchester, in denen es üblich geworden ist, offene Stellen mithilfe eines Verfahrens zu besetzen, das bewusst Geschlecht und Aussehen der Bewerbenden verschleiert. Wer zum Vorspiel eingeladen ist, musiziert hinter einem Vorhang, sodass das Auswahlgremium zunächst nur nach der Qualität des musikalischen Vortrags auswählt. Diese Praxis hat dazu beigetragen, dass inzwischen wesentlich mehr Frauen in Orchester aufgenommen werden als früher.
Gewolltes Nichtwissen kann so der Diskriminierung benachteiligter Gruppen entgegenwirken – ein Ziel, dass zunehmend gesellschaftlich gewollt und gesetzlich vorgegeben ist. Solche Informationen bewusst auszublenden, ist eine ethische Entscheidung. Sie bestimmt, welche Kenntnisse im Sinne der Gesellschaft als nützlich und wertvoll angesehen werden und welche als schädlich für ein faires und solidarisches Miteinander. Das ist übrigens keine neue Entwicklung: Justitia, die Symbolfigur der Rechtsprechung, wird seit dem Mittelalter mit Augenbinde, also blind dargestellt – als Sinnbild für die Anwendung der Gesetze unabhängig von der Person.
Der Umgang mit historischen Fakten
Gesellschaften bestimmen auch, welches Wissen über gemeinsame Vergangenheit gewollt ist. In Deutschland hat sich der Umgang mit historischen Fakten von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute immer wieder verändert. Während die Alliierten direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf schonungslose Aufklärung setzten und die Nazi-Elite auch juristisch zur Rechenschaft zog, folgte in den 1950er- und 1960er-Jahren eine Phase des Verdrängens und Schweigens. Aus heutiger Sicht lässt sich vermuten, dass dieser Umgang mit einer erschütternden Vergangenheit als notwendig erachtet wurde, um den Zusammenhalt der Gesellschaft und den gemeinsamen Wiederaufbau des Landes zu bewältigen. Die 1968er-Generation kämpfte für ein Beenden des Schweigens und Verdrängens und forderte eine echte Auseinandersetzung mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur ein. Dem gewollten Nichtwissen folgte eine gezielte Aufarbeitung von Verbrechen. Ähnliche Phasen von Aufklärung und dem gewollten Nichtwissen finden sich nach dem Ende der DDR.
Deliberate ignorance ist also ein vielfältiges Phänomen, das zahlreiche wissenschaftliche Felder tangiert. Psychologische Ansätze und juristische Aspekte spielen in fast allen Bereichen eine Rolle. Darüber hinaus sind etwa die Folgen medizinischer Diagnosen ein Thema für die Medizinethik. Der Umgang mit finanzieller Vorsorge oder Lohntransparenz beschäftigt die Wirtschaftswissenschaften, die Vermeidung von Diskriminierung ist eine Frage, mit der sich die Soziologie, die Politologie, aber auch die Informatik auseinandersetzen – letztere, um zu vermeiden, dass Algorithmen diskriminierende Stereotypen bedienen. Und Historikerinnen und Historiker befassen sich mit der Bewältigung der Vergangenheit.
Einen interessanten Einblick in das weite Feld des gewollten Nichtwissens bietet der englischsprachige Band „Deliberate Ignorance. Choosing not to Know“, den Ralph Hertwig und Christoph Engel kürzlich in der Serie Strüngmann Forum Reports herausgegeben haben. Er zeigt auch: In der Forschung zum gewollten Nichtwissen sind noch viele interessante Fragen offen.
MEZ