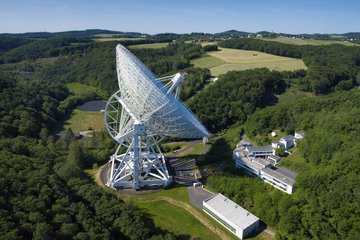Die Triebkräfte der biologischen Vielfalt verstehen
Das erste Max-Planck-Zentrum in Afrika erforscht, wie sich Interaktionen zwischen Arten entwickeln und Vielfalt erzeugen
Die Untersuchung von Verhaltensinteraktionen zwischen Vogelarten sowie zwischen Vögeln und Menschen ist das Ziel des Max-Planck-Zentrums, das das FitzPatrick Institute of African Ornithology der Universität Kapstadt und das Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz gemeinsam gegründet haben. Das „Max Planck-University of Cape Town Centre for Behaviour and Coevolution“ untersucht, wie Verhalten, Kommunikation, Lernen, Evolution und biologische Vielfalt zusammenhängen und wie eine sich verändernde Umwelt diese Beziehungen beeinflusst. Das erste Max-Planck-Zentrum auf dem afrikanischen Kontinent wird die Bildung von starken neuen Verbindungen zwischen den Forschungsgemeinschaften in Afrika und Europa fördern. Das Zentrum wird von der Max-Planck-Förderstiftung finanziell unterstützt. Die offizielle Eröffnung fand am 10. Juni 2024 in Seewiesen in der Nähe von München statt.

Die Vielfalt des Lebens auf der Erde ist größtenteils in den Tropen zu finden, wie etwa in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents. Stabile klimatische Bedingungen haben es vielen Arten ermöglicht, über lange Zeiträume hinweg zu koexistieren und ihr Verhalten und ihre Interaktionen zu koordinieren. Dieser Reichtum an biologischer Vielfalt - sowohl im klassischen Sinne als auch in Bezug auf das Verhalten - ermöglicht es den Forschenden zu untersuchen, wie die Interaktionen zwischen den Arten in ihrer natürlichen Umgebung funktionieren und wie sie sich entwickeln.
Das erste Max-Planck-Zentrum in Afrika vereint das wissenschaftliche und technische Fachwissen, die Erfahrung in der Feldforschung und die Vogelforschungssysteme der beiden Partnereinrichtungen. Das Zentrum wird auch neue Kooperationen entwickeln und bestehende Partnerschaften mit Kollegen in Sambia und Mosambik einbeziehen und erweitern, die außergewöhnliche Fähigkeiten und Ressourcen für die Feldforschung zur Verfügung stellen können.
Eierschalenfarben, Honigguides und wechselnde Lebensräume
Die Forschung am Max-Planck-Zentrum konzentriert sich auf drei Bereiche: Erstens werden die Forschenden die Verhaltensinteraktionen zwischen Brutparasiten und ihren Wirten untersuchen. Brutparasiten sind Vogelarten, die andere Vögel dazu bringen, ihre Eier auszubrüten und ihre Jungen aufzuziehen. Sie versuchen in der Regel, die Eier ihrer Wirte zu imitieren. Die Wirte hingegen entwickeln Strategien, um die Parasiteneier zu erkennen, indem sie beispielsweise das Aussehen ihrer eigenen Eier verändern. Die genetischen und sozialen Faktoren, die Farbe und Muster der Eier prägen, und die Lernprozesse, die ihre Erkennung durch die Wirte bestimmen, sind noch nicht vollständig geklärt.
Zweitens wird das Zentrum die Interaktionen zwischen einer freilebenden Vogelart, dem Großen Honiganzeiger, und Menschen in verschiedenen Regionen Afrikas untersuchen. Diese Partnerschaft ist eines von nur zwei bekannten Beispielen für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Menschen und freilebenden Tieren: Die Vögel helfen den Menschen beim Auffinden von Bienennestern und profitieren von den technischen Fähigkeiten der Menschen beim Zugang zum Inhalt des Nests (einschließlich des Wachses, das die Honiganzeiger verdauen können). Die Forschenden wollen die Mechanismen untersuchen, durch die sich solche kulturellen Verhaltensweisen gemeinsam entwickeln und wie sie die kulturellen Traditionen des jeweils anderen verstärken. Auf diese Weise wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch dazu beitragen, die Zukunft dieses bemerkenswerten Teils des menschlichen Erbes vorherzusagen und zu sichern, da sich die Kulturlandschaft Afrikas rasch verändert und die gegenseitige Beziehung zwischen Honigguiden und Menschen immer mehr verschwindet.
Drittens wollen die Forschungsteams verstehen, wie die Interaktionen zwischen den Arten auf veränderte Umweltbedingungen, wie höhere Temperaturen und trockenere Jahreszeiten, reagieren und sich daran anpassen. So soll beispielsweise untersucht werden, wie sich die Muster und Farben der Eierschalen ändern, wenn die Temperaturen steigen, da die Vögel möglicherweise Kompromisse eingehen müssen, um ihre Eier gleichzeitig vor Überhitzung, Räubern und Brutparasiten zu schützen. Das Team will auch untersuchen, wie der Jahreszyklus tropischer Vögel durch die Mikroben geprägt wird, mit denen sie als Partner oder Feinde interagieren, und wie sich diese Beziehungen in einer sich rasch verändernden Welt möglicherweise neu gestalten.