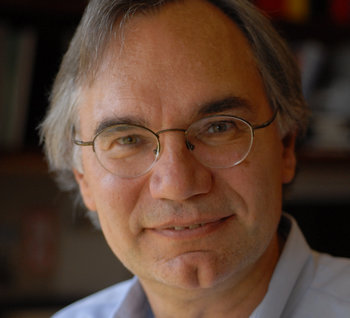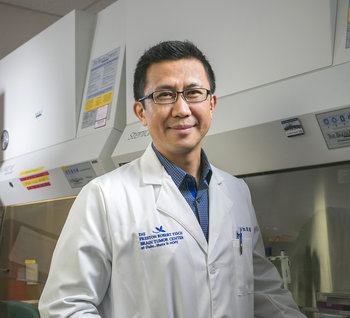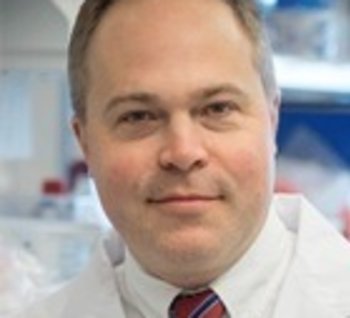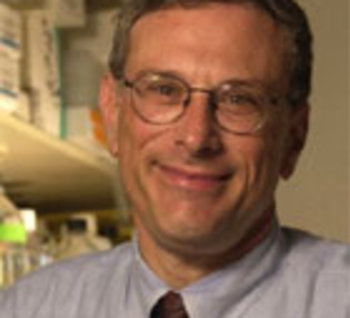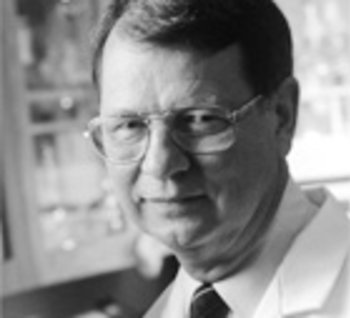Auszeichnung für neurologische Grundlagenforschung
Der "Prize for Translational Neuroscience" der Gertrud Reemtsma Stiftung wird seit 1990 für herausragende Leistungen in der neurologischen Grundlagenforschung vergeben (bis 2019: K-J.-Zülch-Preis). Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wurde in den vergangenen Jahren immer an zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam verliehen.
Preisträger 2024: Für die ausgezeichnete Entschlüsselung des Denkens
Richard A. Andersen studierte Biochemie an der University of California, Davis, und promovierte 1979 im Fach Physiologie an der University of California, San Francisco. Anschließend verbrachte er Forschungsaufenthalte als Postdoc an der Johns Hopkins Medical School und als Assistenzprofessor am Salk-Institut für biologische Studien, Kalifornien. 1987 wurde er erst außerordentlicher Professor, 1990 James G. Bowsell-Professor für Neurowissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seit 1993 ist er Professor für Neurowissenschaften am California Institute of Technology (Caltech), wo er seit 2017 zudem das T&C Brain-Machine-Interface Center leitet. Darüber hinaus ist Richard Andersen Mitglied der National Academy of Sciences, der National Academy of Medicine und der American Academy of Arts and Sciences.
Karl J. Friston studierte 1980 Naturwissenschaften am Gonville and Caius College, Cambridge UK und anschließend Medizin an der King's College Medical School, London University. 1988 schloss er seine Facharztausbildung im Bereich Psychiatrie an der Oxford University ab und ging anschließend für einen Forschungsaufenthalt an das Hammersmith Hospital, London in die Abteilung Neuroimaging. 1992 ging er für zwei Jahre an das Neurosciences Institute La Jolla CA, USA. Seit 1994 forscht er am Institute of Neurology, UK und ist seit 2001 wissenschaftlicher Direktor des Wellcome Trust Centre for Neuroimaging. Seit 2022 ist er außerdem leitender Wissenschaftler der Firma Verses, die sich auf die Entwicklung neuer Formen künstlicher Intelligenz spezialisiert hat.
Preisträger 2023: Für die Entwicklung einer Behandlung erblicher Erblindung
Botond Roska studierte zunächst Cello und Mathematik in Budapest. Anschließend promovierte er in Medizin an der Semmelweis Medical School, graduierte in Neurobiologie an der University of California, Berkeley, und studierte Genetik und Virologie als Harvard Society Fellow an der Harvard University und der Harvard Medical School. Von 2005 bis 2018 leitete er eine Forschungsgruppe am Friedrich-Miescher-Institut in Basel. Seit 2010 ist er Professor an der Medizinischen Fakultät und seit 2019 Professor an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel. Seit 2018 ist er einer der Gründungsdirektoren des Instituts für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel. Dort leitet er eine Forschungsgruppe, die sich auf das Verständnis des Sehens und seiner Krankheiten sowie auf die Entwicklung von Gentherapien zur Wiederherstellung des Sehvermögens konzentriert.
José-Alain Sahel studierte Medizin in Paris und wurde 1984 Ophthalmologe am Louis Pasteur-Universitätskrankenhaus in Straßburg. Nach verschiedenen Forschungstätigkeiten an der Klinik für Augen- und Ohrenerkrankungen und der Universität Harvard wurde er 1988 Professor für Augenheilkunde an der Universität Louis Pasteur in Straßburg und 2002 an der Sorbonne Universität in Paris sowie am University College London. 2008 gründete er das Vision Institute in Paris und leitete es bis 2021. Seit 2023 ist er emeritierter Professor an der Sorbonne Universität. Seit 2016 ist er Stiftungsprofessor und Vorsitzender des Vision Institute am University of Pittsburgh Medical Center.
Preisträger 2022: Erkenntnisse zur Entstehung des Rett-Syndroms
Preisträger 2021: Entscheidende Verbesserungen der Diagnostik von Gehirntumoren
Hai Yan studierte an der Peking University Health Science Center Medizin, an der er 1991 zum Dr. med. promovierte. Anschließend ging er an das College of Physicians and Surgeons der Columbia University, New York und erlangte 1996 seinen Ph.D. im Fachgebiet Molekular- und Zellbiologie. Für weitere Forschungsaufenthalte ging er 1997 an das Howard Hughes Medical Institute der Johns Hopkins University und 2003 an das Duke University Medical Center, an dem er inzwischen Professor für Pathologie und Neuroonkologie ist.
Andreas von Deimling studierte Medizin in Freiburg und begann 1988 seine klinische Ausbildung im Universitätskrankenhaus Zürich, Schweiz. Für weitere Forschungen ging er 1990 an das Neuro-Oncology Department of the Massachusetts General Hospital und 1992 an das Institut für Neuropathologie der Universität Bonn. 1998 wurde er Direktor der Neuropathologie in der Charité der Humboldt University in Berlin. 2007 ging er nach Heidelberg und wurde dort Direktor für Neuropathologie an der Universität Heidelberg und Direktor der Klinischen Kooperationseinheit Neuropathologie am Deutschen Krebsforschungszentrum.
Preisträger 2020: Entfernung von Proteinablagerungen aus dem Gehirn
Mathias Jucker vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Tübingen untersucht in den Flüssigkeiten, die das Gehirn reinigen, Biomarker für neurodegenerative Erkrankungen. So hat er im Blut und in der Gehirnflüssigkeit genetisch veränderter Mäuse Moleküle identifiziert, mit denen sich zum Beispiel schon früh der Verlauf der Alzheimer-Erkrankung voraussagen lässt.
Die Entfernung von Ab aus dem Gehirn ist abhängig von ihrer korrekten dreidimensionalen Struktur: Falsch gefaltete Ab lösen die Fehlfaltung weiterer Ab-Proteinmoleküle aus und bewirken auf diese Weise die Ausbreitung amyloider Plaques. Fehlgefaltete Proteine können dann nicht mehr entfernt werden. Zum Zeitpunkt der ersten neurologischen Symptome haben sich bereits so viele amyloide Plaques gebildet, dass das Gehirn stark geschädigt ist. Viele Therapien greifen zu diesem Zeitpunkt daher nicht mehr. Umso wichtiger ist eine präventive Therapie, bevor die ersten Symptome auftreten.
Maiken Nedergaard vom Medical Center der Universität Rochester und der Universität Kopenhagen hat die Rolle der wichtigsten Helferzellen bei neuronalen Erkrankungen erforscht. Die Wissenschaftlerin konnte zeigen, dass diese als Astrozyten bezeichneten Zellen eine wichtige Rolle bei der Verteilung der Flüssigkeit im Gehirn spielen. Sie bilden Ausläufer, die die Blutgefäße im Gehirn umgeben. Dadurch entstehen Donat-förmige Tunnel, durch die die Flüssigkeit ins Gehirn strömen und Abfallstoffe wie das Ab herauswaschen kann. Der Abtransport wird dabei durch eine hohe Dichte eines speziellen Wasserkanals in den Zellmembranen sichergestellt.
Wegen der großen Bedeutung der Astrozyten für die Drainage des Gehirns bezeichnet Nedergaard den Flüssigkeitstransport als „Glia-lymphatisches System“, kurz: „glymphatisches System“. Der Forscherin zufolge ist das glymphatische System hauptsächlich im Schlaf aktiv: Die Astrozyten schrumpfen im Schlaf und lassen größere Zwischenzellräume zu, in die Hirnflüssigkeit entlang der Blutgefäße eindringen und von dort Ab-Proteine und andere Abfallstoffe abtransportieren kann.
Bei der Alzheimer-Erkrankung lagert sich das sogenannte Amyloid-b (Ab) Protein als Plaques um Nervenzellen ab und schädigt diese. Während in jungen Jahren selten amyloide Plaques im Gehirn auftreten, scheint der Abtransport der Proteine mit fortschreitendem Alter immer schlechter zu funktionieren. Roy Weller von der Universität Southampton wollte herausfinden, wie der Abtransport von Abfallstoffen im Gehirn funktioniert – und warum er mit zunehmendem Alter oft fehlschlägt. Seine Experimente haben ergeben, dass die Drainage des Gehirns entlang der Arterienwände erfolgt: Die Hirnflüssigkeit und die darin enthaltenen Abfallstoffe fließen zunächst zu den Gefäßen, von dort werden sie durch wellenförmiges Zusammenziehen der Gefäßmuskelzellen weiter zu den Lymphknoten im Hals transportiert. Die sehr engen Wege dieses einzigartigen Systems erlauben den Transport von Proteinen und Stoffwechselprodukten, ohne dass Immunzellen ins Gehirn eindringen und dort eine Entzündung auslösen können.
Da die Muskelzellen der Arterien mit der Zeit abgebaut werden, funktioniert dieser Transportweg im Alter schlechter. Zudem können die verklumpten und unlöslichen Ab-Proteine die engen Drainage-Kanäle verstopfen und so ihren Abtransport weiter verschlechtern. Eine Stärkung der Kontraktionsfähigkeit der Arterienmuskelzellen oder eine Auflösung der Ab-Proteine könnte den Abfluss von Ab aus dem Gehirn wiederherstellen und als Ansatz für eine Alzheimer-Prävention und -Therapie dienen.
Preisträger 2019: Therapie bei Muskelschwäche
Adrian Krainer ist Biochemiker und erforscht seit Jahrzehnten, wie Gene in Proteine umgeschrieben und übersetzt werden und wie sich die zugrundeliegenden Mechanismen beeinflussen lassen. Bei der Abschrift eines Gens in RNA müssen Sequenzen, die Informationen für das Protein enthalten, sogenannte Exons, von nicht kodierenden Abschnitten (Introns) getrennt und aneinandergefügt werden. Dieser Editierungsvorgang wird als RNA-Spleißen bezeichnet. Bei der Abschrift des SMN2-Gens wird während dieses Spleißens jedoch durch eine Mutation in einem Exon des SMN2-Gens in den meisten Fällen ein Exon ausgelassen und so nur ein verkürztes Protein hergestellt, das schnell wieder abgebaut wird.
Adrian Krainer hat einen Molekültyp erforscht, durch den fehlerhaftes RNA-Spleißen wieder korrigiert werden kann. Bei den sogenannten Antisense-Oligonukleotiden handelt es sich um kurze RNA-ähnliche Segmente, die an spezifische Stellen in der Abschrift eines Gens binden und so beeinflussen, wie die genetische Information in ein Protein umgesetzt wird. Im Falle des defekten RNA-Spleißens des SMN2-Gens hat Krainer ein 18 Nukleotide langes Molekül entdeckt, mit dessen Hilfe das komplette Protein gebildet wird.
Zusammen mit Ionis Pharmaceuticals testete Krainer ein Nusinersen genanntes Antisense-Oligonukleotid an Mäusen, die kein eigenes SMN-Protein produzieren, sondern zwei Kopien des menschlichen SMN2-Gens besitzen. Diese Mäuse erkranken an schwerer spinaler Muskelatrophie und versterben bereits zehn Tage nach der Geburt. Verabreichte Krainer den Mäusen jedoch Nusinersen vor dem Auftreten von Symptome, entwickelten sie keine Muskelatrophie und überlebten über 250 Tage.
Adrian Krainer studierte Biochemie an der Columbia University und erlangte seinen Doktor in Biochemie und Molekularer Biologie an der Harvard University. Für seine weitere Forschungskarriere ging er an das Cold Spring Harbor Laboratory, wo er zuerst als Postdoc forschte und dann die Professorenlaufbahn einschlug. Dort ist er seit 1994 Professor und seit 2009 St. Giles Foundation Professor.
Nach diesen vielversprechenden Ergebnissen untersuchte Richard Finkel in klinischen Studien Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Nusinersen. Auch hier zeigten sich erstaunliche Ergebnisse. In einer Studie an Säuglingen mit der Typ I-Erkrankung sollte ursprünglich ermittelt werden, ob sich das Überleben der Patienten ohne Beatmungsgerät durch die Gabe von Nusinersen verlängerte. Schnell zeigte sich jedoch, dass sich auch die Patienten durch Nusinersen gut entwickelten.
Die Ergebnisse einer Zwischenanalyse der Studie waren so positiv, dass es ethisch nicht vertretbar war, der Placebo-Gruppe Nusinersen vorzuenthalten. Diese Säuglinge wurden darauf in eine andere Studie aufgenommen, damit auch sie von dem Wirkstoff profitieren konnten. Finkel erkannte, dass erstmals ein Medikament die Bewegungseinschränkungen der Patienten deutlich mildert oder sogar verbessert und das Überleben verlängert. Aufgrund der erfolgreichen klinischen Studien wurde Nusinersen Ende 2016 in den USA als Medikament zugelassen, inzwischen werden rund 7500 Patienten damit behandelt.
Richard Finkel ging nach dem Studium der Chemie und Medizin an die Harvard Medical School und spezialisierte sich dort auf Pädiatrie und Neurologie. Anschließend war er als Pädiater und Neurologe in Krankenhäusern in Denver und Philadelphia tätig. Aktuell ist er Professor für Neurologie an der University of Central Florida und Leiter der Neurologie am Nemours Children‘s Hospital in Orlando.
Preisträger 2018: Das Immunsystem bei neurologischen Erkrankungen
Die emeritierte Neuroimmunologin Angela Vincent forschte zunächst am University College und dem Royal Free Hospital in London. Danach setzte die aus Großbritannien stammende Forscherin ihre Arbeit an der Universität Oxford fort, wo sie bis vor kurzem eine Forschungsgruppe unterhielt.
Jerome Posner, Angela Vincent und Josep Dalmau haben die Erforschung dieser Autoimmunerkrankungen des Nervensystems maßgeblich vorangetrieben und detailliert beschrieben. Sie haben zudem Tests entwickelt, mit denen Ärzte Patienten schnell erkennen und behandeln können. Dadurch haben die Forscher Wege eröffnet, den Ausbruch der Erkrankungen zu verhindern oder sie zu behandeln. Darüber hinaus hat die Diagnose der neurologischen Syndrome bei Krebspatienten – sogenannte paraneoplastische Syndrome – die Entdeckung zuvor unbekannter Krebsformen ermöglicht und die Überlebenschancen der Betroffenen erhöht.
Angela Vincent hat zunächst Autoimmunerkrankungen des peripheren Nervensystems erforscht, bei denen die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel gestört ist. Dies führte die Britin zu der damals revolutionären Erkenntnis, dass manche Antikörper auch das Zentralnervensystem angreifen können. Auch sie hat Diagnosemethoden entwickelt, die heute in Kliniken vielfach eingesetzt werden.
Josep Dalmau arbeitete nach seinem Medizinstudium in Barcelona zunächst als Neurologe, bevor er im Labor von Jerome Posner seine wissenschaftliche Laufbahn vertiefte. Zurzeit hält er Professuren an der Universität von Pennsylvania sowie der Universität Barcelona.
Jerome Posner, Angela Vincent und Josep Dalmau haben die Erforschung dieser Autoimmunerkrankungen des Nervensystems maßgeblich vorangetrieben und detailliert beschrieben. Sie haben zudem Tests entwickelt, mit denen Ärzte Patienten schnell erkennen und behandeln können. Dadurch haben die Forscher Wege eröffnet, den Ausbruch der Erkrankungen zu verhindern oder sie zu behandeln. Darüber hinaus hat die Diagnose der neurologischen Syndrome bei Krebspatienten – sogenannte paraneoplastische Syndrome – die Entdeckung zuvor unbekannter Krebsformen ermöglicht und die Überlebenschancen der Betroffenen erhöht.
Jerome Posner gilt als Pionier der Erforschung dieser Erkrankungen und ihrer Ursachen. Er hat verschiedene paraneoplastische Syndrome systematisch beschrieben und die ersten Bluttests zur Diagnose entwickelt. Sein früherer Mitarbeiter Josep Dalmau hat mehrere Formen autoimmuner Gehirnentzündung entdeckt und aufgeklärt, wie die Antikörper des Immunsystems direkt zu Ausfallerscheinungen im Gehirn führen können. Darüber hinaus hat er Diagnoseverfahren dafür entwickelt.
Der US-Amerikaner Jerome Posner leitete die Abteilung für Neuroonkologie am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York und war Professor für Neurologie und Neurowissenschaft an der Cornell Universität in New York.
Preisträger 2017: Schlaf, Koma und Bewusstsein
Der Fokus von Steven Laureys liegt auf den neuronalen Grundlagen von Bewusstsein und die durch Schädigungen des Gehirns hervorgerufenen Veränderungen. Ärzte müssen täglich den Bewusstseinszustand von Koma-Überlebenden einschätzen, die nicht mit anderen kommunizieren können. Dabei ist es entscheidend für die Prognose des Patienten, seinen Zustand richtig einzuordnen und die dafür geeignete Therapie zu finden. Lange waren die Diagnoseverfahren hierfür sehr ungenau. Laureys und seinem Team ist es mithilfe einer Kombination von Bildgebungsverfahren und elektrophysiologischen Methoden gelungen, die Behandlung von Koma- und Wachkoma-Patienten sowie Menschen mit "Locked-in"-Syndrom auf eine neue Grundlage zu stellen.
Besonders wichtig war dabei ihr Befund zu einem jungen Mann, der irrtümlich als Wachkoma-Patient eingestuft worden war. Ihre Untersuchungen ergaben, dass der Patient ähnliche Aktivitätsmuster im Gehirn zeigte wie gesunde Probanden, wenn sie sich vorstellten, Tennis zu spielen. Dies konnten die Forscher zur Kommunikation mit dem Patienten nutzen. In einer Studie an 54 Patienten mit chronischen Bewusstseinsstörungen konnte Laureys daraufhin zeigen, dass zehn Prozent von ihnen ihre Hirnaktivität willentlich steuern konnten, obwohl sie nicht mit der Außenwelt kommunizieren konnten.
Diese methodisch sehr komplexen Untersuchungen bilden heute die Grundlage für die Diagnostik von Bewusstseinsstörungen. Dadurch können nicht nur therapeutische Strategien genauer angepasst werden, sondern auch die klinische Pflege und nicht zuletzt die Lebensqualität von Patienten mit Bewusstseinsstörungen verbessert werden.
Steven Laureys erlangte seinen Doktor in Medizin an der Vrije Universiteit Brussel, wo er sich anschließend auf Neurologie spezialisierte. Gleichzeitig begann er dort seine Forschungskarriere und graduierte 1997 als Master of Science in Pharmazeutischer Medizin. Er wechselte an die Universität Lüttich, an der er 2000 promovierte. Steven Laureys ist Direktor am Belgian National Fund of Scientific Research. Er leitet das GIGA Zentrum für Bewusstseinsforschung und die Koma Forschungsgruppe an der Universität Lüttich.
Mithilfe seiner über viele Jahre hinweg gewonnenen Daten haben Giulio Tononi und sein Team eine Hypothese über die Funktionen des Schlafs entwickelt, die sogenannte "Synaptic Homeostasis Hypothesis". Demnach besteht die zentrale Funktion des Schlafes darin, die synaptischen Verbindungen zwischen Nervenzellen wieder in ihren Normalzustand zu versetzen. Im Wachzustand zur Verarbeitung von Informationen verstärkte oder neu gebildete Synapsen werden dabei wieder abgeschwächt. Ohne Schlaf und Normalisierung der synaptischen Übertragung würden immer mehr Synapsen gestärkt und neue Synapsen gebildet. Das Gehirn stieße so bald an seine Grenzen und könnte keine neuen Informationen aufnehmen und verarbeiten.
Die Veränderungen der Hirnaktivität während des Schlafens macht sich Tononi auch zunutze, um Erkenntnisse über das Bewusstsein des Menschen zu erlangen. Mit der "Integrated Information Theory" hat er eine Theorie über das Entstehen von Bewusstsein entwickelt, die nicht wie die meisten anderen Theorien erklären soll, wie das menschliche Gehirn Bewusstsein entwickeln kann, sondern die Fragestellung umkehrt. Sie identifiziert die wesentlichen Eigenschaften des Bewusstseins und fragt dann, welche Mechanismen im Gehirn dafür verantwortlich sein könnten. Neben ihrer neurophilosophischen Bedeutung findet Tononis Theorie Anwendung bei Erkrankungen, die mit veränderten Bewusstseinszuständen einhergehen.
Giulio Tononi wurde an der Universität Pisa zum Mediziner mit Spezialisierung Psychatrie und Neurowissenschaften ausgebildet. Von 1990-2000 war er zuerst in New York, dann in San Diego Mitglied des "Neurosciences Institute". Er ist aktuell Professor für Psychatrie und Wissenschaft des Bewusstseins, hat den David P.White Lehrstuhl in Schlafmedizin an der Universität Wisconsin- Madison inne und ist Direktor des "Wisonsin Insitute for Sleep and Consciousness".
Preisträger 2016: Krebsformen im Kleinhirn
Im Gehirn und Rückenmark gibt es mehr als hundert verschiedene Arten von Tumoren, die unterschiedlich auf Behandlungen ansprechen. Was dem einen Patienten Heilung bringt, ist bei dem anderen wirkungslos. Unklar ist oft: Was hilft wem? Stefan Pfister vom Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg und Michael Taylor von der Universität Toronto und dem dortigen Hospital for Sick Children (SickKids) haben mit ihrer Forschung dazu beigetragen, die Diagnose und Behandlung von Gehirntumoren entscheidend zu verbessern. Sie haben unter anderem gezeigt, dass der bei Kindern häufigste bösartige Hirntumor, das sogenannte Medulloblastom, sich in vier unterschiedliche Kategorien einteilen lässt, die jeweils individuell behandelt werden müssen. Damit wird es erstmals möglich, diese Arten von Krebs gezielt zu bekämpfen. In Anerkennung ihrer Leistung erhalten die beiden Wissenschaftler den mit 50.000 Euro dotierten K. J. Zülch-Preis der Gertrud Reemtsma Stiftung.
Stefan M. Pfister hat an den Universitäten Hamburg und Tübingen Medizin studiert. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Harvard Medical School, USA, kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete unter anderem im Universitätskrankenhaus Mannheim, im Universitätsklinikum Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. 2012 übernahm er mit einer Startprofessur im Rahmen der Exzellenzinitiative die Leitung der Abteilung pädiatrische Neuroonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum. Seit 2014 ist er Professor für Kinderheilkunde an der Universität Heidelberg.
Im Gehirn und Rückenmark gibt es mehr als hundert verschiedene Arten von Tumoren, die unterschiedlich auf Behandlungen ansprechen. Was dem einen Patienten Heilung bringt, ist bei dem anderen wirkungslos. Unklar ist oft: Was hilft wem? Stefan Pfister vom Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg und Michael Taylor von der Universität Toronto und dem dortigen Hospital for Sick Children (SickKids) haben mit ihrer Forschung dazu beigetragen, die Diagnose und Behandlung von Gehirntumoren entscheidend zu verbessern. Sie haben unter anderem gezeigt, dass der bei Kindern häufigste bösartige Hirntumor, das sogenannte Medulloblastom, sich in vier unterschiedliche Kategorien einteilen lässt, die jeweils individuell behandelt werden müssen. Damit wird es erstmals möglich, diese Arten von Krebs gezielt zu bekämpfen. In Anerkennung ihrer Leistung erhalten die beiden Wissenschaftler den mit 50.000 Euro dotierten K. J. Zülch-Preis der Gertrud Reemtsma Stiftung.
Michael Taylor hat an der Universität Western Ontario, Kanada, Medizin studiert und sich dann an der Universität Toronto auf Chirurgie spezialisiert. Nach einem Forschungsaufenthalt in Memphis, USA, zog er zurück nach Toronto und wurde 2004 Neurochirurg am Hospital for Sick Children in Toronto, Kanada.
Preisträger 2015: Revolution in der Mikroskopie
Wer das Gehirn verstehen will, muss den mikroskopisch kleinen Schalteinheiten im Gehirn bei der Arbeit zuschauen können - den Nervenzellen. Mit den herkömmlichen Lichtmikroskopen geht das nicht. Erst die Mikroskope von Winfried Denk und seinen Kollegen machen die Gestalt von Nervenzellen und ihre Veränderungen im intakten Gehirn sichtbar. Neurowissenschaftler können dadurch heute Nervenzellen im lebenden Gehirn beobachten und dreidimensionale Bilder von Nervengewebe mit all seinen synaptischen Verbindungen erzeugen.
Mit dem Lichtmikroskop fing alles an: Einfache Glaslinsen und einfaches Sonnenlicht genügten den Forschern des 17. Jahrhunderts, um erstmals Zellen beobachten zu können. Heute arbeiten schon Schüler mit Lichtmikroskopen, wenn sie Zellen im Biologie-Unterricht beobachten sollen. Doch Wissenschaftler stoßen mit Lichtmikroskopen schnell an ihre Grenzen; Nervenzellen beispielsweise erscheinen oft unscharf, weil umgebendes Nervengewebe das Licht im Mikroskop zu stark streut. Details bleiben so verborgen. Auch die Aktivität der Zellen lässt sich mit Lichtmikroskopen nicht sichtbar machen.
Mit dem Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskop, das Winfried Denk in den späten 1980er Jahren gemeinsam mit Jim Strickler und Watt Webb an der Cornell Universität in den USA entwickelte, können Forscher dagegen Nervenzellen mit bis dahin unerreichter Klarheit untersuchen. Aber nicht nur das: Mit einem Zwei-Photonen-Mikroskop können sie die Zellen sogar im lebenden Gehirn und über lange Zeitspannen hinweg beobachten. Ein weiterer Vorteil: Das Licht dringt tief ins Gewebe ein und macht auch Zellen sichtbar, die bis zu einem Millimeter unter der Oberfläche liegen. Das ist etwa 20-mal tiefer als ein herkömmliches Lichtmikroskop in Nervengewebe eindringen kann.
Inzwischen erforschen Neurowissenschaftler weltweit mit Zwei-Photonen-Mikroskopen die Funktionsweise von Nervenzellen. Ohne die Technik wären viele Erkenntnisse über das Gehirn der letzten Jahre nicht möglich gewesen - eine Entwicklung, die zu der Geburtsstunde der Zwei-Photonen-Mikroskopie vor 25 Jahren nicht absehbar war.
Zwei-Photonen-Mikroskope sind eine weiterentwickelte Form der Fluoreszenzmikroskopie. Herkömmliche Fluoreszenzmikroskope verwenden kurzwelliges blaues oder ultraviolettes Licht und regen damit Farbstoffe in der Zelle zum Leuchten an. Dadurch wird die Zelle für den Beobachter sichtbar. Gleichzeitig schädigt das energiereiche Licht aber auch die Zelle. Beim Zweiphotonen-Fluoreszenzmikroskop wird dagegen energiearmes rotes oder infrarotes Laserlicht verwendet. Lichtteilchen (Photonen) mit dieser Wellenlänge besitzen jedes für sich jedoch nicht genug Energie, um den Farbstoff anzuregen. Wenn aber zwei Photonen gleichzeitig auf ein Farbstoffmolekül treffen, addiert sich ihre Energie und bringt den Farbstoff zum Leuchten. Auf diese Weise können Forscher die bäumchenartigen Fortsätze von Nervenzellen mit ihren Synapsen analysieren. Farbstoffe, die nur in aktiven Nervenzellen zum Leuchten angeregt werden, verraten den Wissenschaftlern darüber hinaus, wann und wie stark eine Zelle elektrisch aktiv ist.
Winfried Denk interessiert sich jedoch nicht nur für einzelne Nervenzellen und ihre Aktivität, er möchte auch die Verknüpfungen der Zellen untereinander aufklären. Sein Ziel ist es, ein komplettes Verschaltungsdiagramm des Gehirns einer Maus zu erstellen, das Konnektom. Dafür hat er vor rund zehn Jahren das serielle Raster-Elektronenmikroskop entwickelt ("serial block-face"- Raster-Elektronenmikroskop). Im Unterschied zum Zwei-Photonen-Mikroskop beleuchtet es das Gewebe nicht mit Licht, sondern mit einem Elektronenstrahl. Dadurch kann das serielle Raster-Elektronenmikroskop noch kleinere Details sichtbar machen, allerdings nicht in lebendem Gewebe.
Die Probe wird zunächst in einem speziellen Verfahren präpariert und anschließend von einem Elektronenstrahl abgescannt. Ein Schneide-Automat entfernt anschließend eine nur wenige Tausendstel Millimeter dünne Gewebeschicht für das nächste Bild. Aus den zweidimensionalen Bildern der einzelnen Ebenen können die Forscher am Computer ein dreidimensionales Bild zusammensetzen.
Denk ist es damit gelungen, die mühsame und fehleranfällige Produktion der Schnittserien zu automatisieren. Mit dieser Methode haben er und seine Kollegen bereits Schaltkreise der Netzhaut im Auge einer Maus analysiert. Allein in einem Netzhaut-Würfel mit einem Zehntel Millimeter Kantenlänge entdeckten die Wissenschaftler knapp 1000 Nervenzellen mit rund einer halben Million Verbindungen. Angesichts dieser Zahlen lässt sich leicht vorstellen, wie komplex das Konnektom des 200.000-mal größeren Mäusegehirns ist. Nur mit einem solchen Schaltplan können Wissenschaftler aber die Funktionsweise des Gehirns entschlüsseln und Erkrankungen des Nervensystems besser verstehen.
Winfried Denk ist in München geboren und hat in seiner Heimatstadt an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie in Zürich (Schweiz) an der Eidgenössisch Technischen Hochschule Physik und Biophysik studiert. Seine Doktorarbeit schrieb er an der Cornell University in den USA im Labor von Watt W. Webb. Nach einem kurzen Aufenthalt im IBM-Forschungslabor in Rüschlikon (Schweiz) arbeitete er mehrere Jahre in den Bell Laboratories im US-Bundesstaat New Jersey. 1999 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Direktor am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Seit 2002 ist er Honorarprofessor an der Universität Heidelberg. Inzwischen ist er Direktor der Abteilung Elektronen-Photonen-Neuronen am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei München.
Preisträger 2014: Erforschung von Stoffwechselerkrankungen
Jeffrey M. Friedman hat die Rolle des Leptins intensiv erforscht und herausgefunden, dass es die Schwankungen der Energiereserven in engen Grenzen hält. Leptin wird von den Fettzellen des Körpers gebildet, die das Hormon an die Blutbahn abgeben. Die Menge spiegelt dabei die zur Verfügung stehenden Fettreserven wider: Bei einem hohen Fettanteil wird bis zu 100-mal mehr Leptin ausgeschüttet, als Folge davon geht auch das Körpergewicht zurück. Verabreichten die Forscher Mäusen, denen das Leptin-Gen fehlt, das Hormon, verloren die Tiere ihren Appetit, die Blutzucker-Werte und das Körpergewicht sanken.
Ziel des Leptins ist das Gehirn, genauer der Hypothalamus. Dort hat Friedman Nervenzellen entdeckt, die mit einem Rezeptor für das Leptin ausgestattet sind. Bindet das Hormon an diese Rezeptoren, verändert es die Verschaltung von Nervenzellen, die das Essverhalten steuern, und verringert den Genuss, den das Essen hervorruft.
Friedmans Entdeckung des Leptin-Gens in der Maus und O’Rahillys Erkenntnisse zur Bedeutung für den menschlichen Körper gelten manchen als wichtigste Meilensteine in der Stoffwechselforschung seit der Entdeckung des Insulins. Sie hat inzwischen auch zu neuen Therapien geführt: Leptin wird heute beispielsweise zur Behandlung von Patienten mit Lipodystrophie eingesetzt – eine Erkrankung, die zu schwerem Diabetes führen kann.
Jeffrey M. Friedman ist in Orlando, Florida, geboren und hat in Albany im Bundesstaat New York Medizin studiert. Er forscht und lehrt an der Rockefeller Universität und dem Howard Hughes Medical Institute in New York.
Dank der Forschung von Sir Stephen O’Rahilly und seiner Kollegen kennen wir heute eine Reihe von erblichen Stoffwechselerkrankungen, die auf der Veränderung einzelner Gene – manchmal nur eines einzelnen – beruhen. Übergewicht und Fettleibigkeit können demnach Folge einer einzigen Genveränderung sein. O’Rahilly hat beispielsweise nachgewiesen, dass Mutationen im Leptin- und dem Melanocortin-4-Rezeptor-Gen Fettleibigkeit hervorrufen können.
Viele dieser Gene sind in den Nervenzellen des Gehirns aktiv und regulieren dort deren Aktivität. Auf diese Weise steuern sie beispielsweise das Essverhalten. Übergewicht ist also nach heutiger Auffassung häufig eine erbliche Erkrankung, die von äußeren Faktoren wie Ernährung und Bewegung lediglich beeinflusst wird – eine Erkenntnis zu der O’Rahilly maßgeblich beigetragen hat.
Friedmans Entdeckung des Leptin-Gens in der Maus und O’Rahillys Erkenntnisse zur Bedeutung für den menschlichen Körper gelten manchen als wichtigste Meilensteine in der Stoffwechselforschung seit der Entdeckung des Insulins. Sie hat inzwischen auch zu neuen Therapien geführt: Leptin wird heute beispielsweise zur Behandlung von Patienten mit Lipodystrophie eingesetzt – eine Erkrankung, die zu schwerem Diabetes führen kann.
Stephen O’Rahilly ist ebenfalls Mediziner. Er stammt aus Irland und hat an der National University of Ireland in Dublin studiert. Seit 2002 ist er Professor für Klinische Biochemie und Medizin an der Universität Cambridge, Großbritannien, und hat darüber hinaus verschiedene Forschungseinrichtungen am dortigen Addenbrooke’s Hospital geleitet.
Preisträger 2013: Belohnung- und Entscheidungssystem im Gehirn
Dank der Forschung von Wolfram Schultz und Raymond Dolan sind heute verschiedene regulierende Systeme für Lern- und Entscheidungsprozesse bekannt. Diese Netzwerke vermitteln Belohnung, Gefühle und Aufmerksamkeit und beeinflussen damit die Entscheidungsprozesse im Gehirn. Die beiden Forscher haben maßgeblich dazu beigetragen, die Rolle der verschiedenen Gehirnzentren bei der Vermittlung einer Belohnung aufzuklären.
Beim Menschen funktioniert das Belohnungssystem auf ganz ähnliche Weise, wie die Untersuchungen von Raymond Dolan ergeben haben. Er hat dazu Bildgebungsverfahren wie die funktionelle Kernspin-Tomografie eingesetzt, um die Rolle von Dopamin bei Entscheidungsprozessen zu analysieren. So konnte er beispielsweise klären, warum ältere Menschen schlechter Entscheidungen treffen können, wenn sie in einer unberechenbaren Umwelt die Höhe einer zu erwartenden Belohnung abschätzen müssen. Offenbar gehen mit zunehmendem Alter dopaminerge Nervenzellen zugrunde – ein Verlust, der mit zunehmendem Alter unterschiedlich stark auftritt, ohne dass dies körperliche Einschränkungen verursacht. Durch Gabe des Dopamin-Agonisten L-Dopa, der auch in der Parkinson-Therapie angewandt wird, konnte Dolan die Lernleistung und die Entscheidungsfähigkeit älterer Probanden wieder so weit verbessern, dass ihre Leistungsfähigkeit wieder der von Mittzwanzigern glich.
Darüber hinaus hat Dolan mit seinem Ansatz, Bildgebungsverfahren, Computermodelle und pharmakologische Tests zu kombinieren, zwei parallel arbeitende, voneinander unabhängige Entscheidungswege im Gehirn entdeckt. Der eine Pfad läuft mittig über den sogenannten Nucleus caudatus und ist aktiv, wenn das Gehirn die Konsequenzen einer Entscheidung im Geist durchspielt. Der andere nimmt den seitlichen Weg über das Putamen und ermöglicht Entscheidungen auf der Basis erlernter Erfahrungen und Gewohnheiten. Nach der Gabe von L-Dopa trifft das Gehirn bevorzugt Entscheidungen anhand möglicher Konsequenzen und weniger aufgrund früherer Erfahrungen.
Dolan hat zudem wichtige Erkenntnisse darüber gesammelt, wie das Gehirn soziale Entscheidungen trifft, z. B. warum Menschen dazu neigen, negative Informationen zu ignorieren und die Wahrscheinlichkeit künftiger negativer Ereignisse unterschätzen. Höhere Dopamin-Spiegel verstärken dieses Phänomen und führen dazu, dass das Gehirn negative Informationen noch stärker vernachlässigt.
Raymond Dolan stammt aus Irland und hat an der National University of Ireland in Galway Medizin studiert. Er war für verschiedene Kliniken tätig, darunter das National Hospital for Neurology and Neurosurgery, und ist heute Direktor des Wellcome Trust Centers for Neuroimaging des University College London. Seit 2012 ist er zudem Auswärtiges Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
Dank der Forschung von Wolfram Schultz und Raymond Dolan sind heute verschiedene regulierende Systeme für Lern- und Entscheidungsprozesse bekannt. Diese Netzwerke vermitteln Belohnung, Gefühle und Aufmerksamkeit und beeinflussen damit die Entscheidungsprozesse im Gehirn. Die beiden Forscher haben maßgeblich dazu beigetragen, die Rolle der verschiedenen Gehirnzentren bei der Vermittlung einer Belohnung aufzuklären.
So hat Wolfram Schultz herausgefunden, dass Belohnungen Dopamin-Zellen im Mittelhirn aktivieren. Er hat dazu Konditionierungsexperimente mit Affen durchgeführt, in denen die Tiere lernen sollten, einen neutralen Reiz mit einer Belohnung zu verknüpfen. Haben die Tiere gelernt, den Reiz mit einer Belohnung zu verknüpfen, erzeugen die Zellen im Tegmentum als Reaktion auf den Reiz eine kurze Salve elektrischer Signale. Bleibt nach dem Reiz die Belohnung aus, verstummen die Neurone. Sie passen dabei ihre Aktivität an die Höhe der Belohnung an. Und nicht nur das: Die Zellen vergleichen sogar die Höhe der tatsächlichen mit der erwarteten Belohnung und unterscheiden, ob eine Belohnung ihrer Erwartung entspricht. Fällt sie höher aus, werden die Zellen aktiv. Ist sie geringer, bleiben die Zellen stumm.
Damit hat Wolfram Schultz die biologischen Grundlagen für wesentliche Annahmen der psychologischen Lerntheorie für Belohnung entdeckt. Darüber hinaus hat er Erkenntnisse aus der Lern- und der ökonomische Entscheidungstheorie benutzt, um Belohnungs- und Risikosignale in Dopamin-Zellen und anderen Teilen des Belohnungssystems zu finden.
Wolfram Schultz ist in Meissen geboren und hat in Hamburg und Heidelberg Medizin, Mathematik und Philosophie studiert. Nach Forschungsaufenthalten am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, in Buffalo und Stockholm forschte und lehrte er von 1977 bis 2001 an der Universität Fribourg (Schweiz) und arbeitet seit 2001 an der Universität Cambridge.
Preisträger 2012: Begründer der Optogenetik
Die Preisträger haben das Forschungsgebiet der Optogenetik begründet und maßgeblich befördert. Dank ihrer Forschung ist es heute möglich, Nerven- und Muskelzellen mit hoher zeitlicher und räumlicher Genauigkeit anstelle mit Elektroden mit Licht zu aktivieren oder still zu legen. Ernst Bamberg hat zusammen mit seinen Kollegen Peter Hegemann und Georg Nagel die besonderen Eigenschaften lichtempfindlicher Ionenkanäle in einzelligen Algen entdeckt, der sogenannten Channelrhodopsine.
Karl Deisseroth erkannte frühzeitig das enorme Potenzial der Channelrhodopsine für die Neurowissenschaften. 2005 übertrug er zusammen mit Georg Nagel und Ernst Bamberg Channelrhodopsin-2 in Nervenzellen des Gehirns von Ratten und konnte so erstmals mithilfe der Optogenetik Aktionspotenziale auslösen. Darüber hinaus gelang es ihm, Channelrhodopsine im Gehirn sich frei bewegender Ratten zu aktivieren. Dazu leitete er das Licht durch Glasfaserkabel direkt ins Gehirn. Auf diese Weise konnte er in unterschiedlichen Tierarten untersuchen, wie Nervenzellen Verhaltensweisen wie Bewegung, Furcht oder soziales Verhalten erzeugen und wie Lern- und Gedächtnisvorgänge ablaufen.
Peter Hegemann begann bereits 1985 am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried mit der Forschung über die Lichtwahrnehmung von Algen. In den Jahren 2002 und 2003 konnte er an der Universität Regensburg zusammen mit Georg Nagel und Ernst Bamberg die außergewöhnliche Funktion der Algen-Rhodopsine beweisen: Durch die Übertragung des Rhodopsin-Gens auf Eizellen des Krallenfrosches stellten sie fest, dass die Algen-Rhodopsine Lichtrezeptor und Ionenkanal in einem einzigen Protein vereinen.
Georg Nagel erforscht die elektrophysiologischen Eigenschaften von Algen-Rhodopsinen seit Beginn der 1990er Jahre. Von 1995 an gelang es ihm und Ernst Bamberg am Max-Planck-Institut für Biophysik, verschiedene bakterielle Rhodopsine auf Froscheier und menschliche Nierenzellen zu übertragen und ihre elektrophysiologischen Eigenschaften zu beschreiben.
Preisträger 2011: Parkinson-Forschung
Thomas Gasser hat das Erbgut solcher Familien untersucht und dabei verschiedene Gene ausfindig gemacht, die zu Parkinson und anderen Bewegungsstörungen, wie dem Myoklonus-Dystonie-Syndrom führen können. So hat er das Gen LRRK2 als den bislang häufigsten bekannten Auslöser für eine erbliche Form von Parkinson identifiziert.
Seine Arbeiten haben darüber hinaus gezeigt, dass auch für die häufigere sporadische Form der Erkrankung genetische Faktoren wichtig sind. Diese Mutationen kommen in der Bevölkerung relativ häufig vor, jede für sich genommen erhöht das Krankheitsrisiko jedoch nur minimal. In ihrer Kombination und möglicherweise auch im Zusammenspiel mit bestimmten Umweltfaktoren entwickeln sie jedoch ihre schädigende Wirkung. Diese Erkenntnisse liefern nun erstmals die Basis dafür, die Ursachen der Parkinsonkrankheit selbst behandeln zu können und nicht nur ihre Symptome zu lindern.
Der 1958 in Stuttgart geborene Mediziner spezialisierte sich schon früh auf die Genetik neurologischer Erkrankungen. Nach einem Forschungsaufenthalt in Boston war er mehrere Jahre an der Universitätsklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. Seit 2003 ist er Ärztlicher Direktor der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt neurodegenerative Erkrankungen am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und der Universitätsklinik Tübingen und seit 2010 Standortsprecher des Standorts Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
Robert L. Nussbaum beschäftigt sich mit den genetischen Ursachen von Parkinson und dem Lowe-Syndrom. 1997 hat er als Erster mit alpha-Synuclein ein Gen entdeckt, das in mutierter Form Parkinson hervorruft. Er hat damit den Weg für die Erforschung weiterer genetischer Ursachen neurologischer Erkrankungen bereitet. Zudem hat sich gezeigt, dass Veränderungen des alpha-Synuclein-Gens nicht nur die Ursache einer seltenen vererbbaren Form von Parkinson sein können, sondern dass auch das unveränderte Gen ein zentrales Merkmal aller Parkinson-Erkrankungen ist. Darüber hinaus hat Robert L. Nussbaum beobachtet, dass sich in Mäusen, die eine mutierte Form des Gens besitzen, das vegetative Nervensystem krankhaft verändert bevor Veränderungen im Gehirn auftreten – ähnlich wie es bei Parkinson-Patienten der Fall ist. Auch dank seiner Forschung wird Parkinson heute nicht mehr als reine Krankheit des Gehirns, sondern des gesamten Organismus angesehen.
Das zweite Augenmerk des 60-jährigen Mediziners, der zuvor am Nationalen Gesundheitsinstitut NIH bei Washington und an der Universität von Pennsylvania tätig war, gilt der Erforschung des Lowe-Syndroms. Diese seltene Erbkrankheit wird über das X-Geschlechtschromosom vererbt und führt zu geistiger Behinderung, Krampfanfällen, Trübung der Augenlinsen und Nierenschäden. Die meisten Patienten sterben bereits im Jugendalter. Anfang der 1990er Jahre identifizierte Robert L. Nussbaum das OCRL1 als Krankheitsursache. Das zugehörige Protein ist am Fettstoffwechsel beteiligt und ist im Sortier- und Transportorganell der Zellen, dem Golgi-Apparat, sowie an der Zelloberfläche aktiv. Es wird für den Transport mancher Proteine zwischen Zellinnern und -oberfläche benötigt. Was seine genaue Funktion dabei ist und warum sein Ausfall so unterschiedliche Körperorgane beeinträchtigt, ist noch unklar. Das Team von Robert L. Nussbaum entwickelte Testsysteme, mit denen die Erkrankung bereits im Fötus festgestellt werden kann, und bot als erstes Labor betroffenen Familien Genanalysen sowie Beratung an.
Preisträger 2010: Multiple-Sklerose-Forschung
Prof. Alastair Compston ist 1948 in London geboren und erforscht seit über 30 Jahren die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Multipler Sklerose. Er studierte Medizin an der Middlesex Hospital Medical School. In den 1980er Jahren arbeitete er am University Hospital of Wales, bevor er 1989 an die University of Cambridge wechselte, wo er heute die Abteilung für klinische Neurowissenschaften leitet. 2001 trieb Prof. Compston die Gründung des International Multiple Sclerosis Genetics Consortium voran, eines Forschungsverbundes mit dem Ziel, Risiko-Gene für die Erkrankung zu identifizieren. Dank dieser groß angelegten Genanalyse ist heute eine wachsende Zahl von Genveränderungen bekannt, die die Anfälligkeit für Multiple Sklerose erhöhen oder erniedrigen können. Darüber hinaus ist er maßgeblich an der Erforschung der neurobiologischen Ursachen für die Schädigung der Myelin-bildenden Zellen beteiligt.
Zudem untersucht Prof. Compston die Wirkung eines möglichen neuen Wirkstoffes auf den Verlauf der Erkrankung, des Antikörpers Alemtuzumab. Mit Alemtuzumab lässt sich unterbinden, dass verschiedene Arten von Immunzellen aus dem Blut ins Gehirn einwandern und dort Entzündungen an den Nervenfortsätzen hervorrufen. Alemtuzumab kann die Beschwerden von Patienten im Frühstadium lindern, bei Patienten mit fortgeschrittener Multipler Sklerose ist die Therapie hingegen wirkungslos. Diese Entdeckung zeigt, dass es Krankheitsphasen gibt, in denen unterschiedliche Faktoren den weiteren Verlauf bestimmen. So dominiert in der Anfangsphase das Immunsystem das Krankheitsgeschehen, später sind neurodegenerative Veränderungen im Nervensystem vorherrschend.
Prof. Hans Lassmann ist 1949 in Wien geboren. Er hat in Wien Medizin studiert und begann seine klinische Ausbildung am neurologischen Institut der Universität Wien. Nach seiner Basisausbildung wechselte er zu einem Auslandsaufenthalt an das Institute of Basic Research in Developmental Disabilities, Staten Island, New York. Hier begannen seine Arbeiten auf dem Gebiet der demyelinisierenden Erkrankungen. Mit diesem Aufenthalt betrat Hans Lassmann das Feld der Neuroimmunologie, das er seitdem als eines seiner wissenschaftlichen Schwerpunktthemen nicht wieder verlassen hat. 2007 war er Gründungsdirektor des Zentrums für Gehirnforschung der Medizinischen Universität Wien, an der bis heute lehrt und forscht.
Auf die Forschung Hans Lassmanns geht im Wesentlichen die Erkenntnis zurück, dass Multiple Sklerose von Patient zu Patient unterschiedlich sein kann. Er konnte aufgrund morphologischer Untersuchungen vier unterschiedliche Erkrankungstypen differenzieren. Verschiedene Zellarten sind dabei offenbar für die Zerstörung der Isolierschicht um die Nervenzellen verantwortlich. Die Multiple Sklerose ist demnach eine vielgestaltige Erkrankung, die entsprechend individuell behandelt werden muss. So konnte Hans Lassmann zeigen, dass Patienten mit einer Typ-II-Erkrankung, die gegen entzündungshemmende Steroide unempfindlich sind, von einer Plasmapherese profitieren. Dabei werden die krankmachenden Antikörper des Immunsystems aus dem Blut ausgewaschen.
Hans Lassmann hat also mit seiner Klassifikation die Frage aufgeworfen, ob die Multiple Sklerose tatsächlich eine Einheit darstellt, oder ob sich dahinter nicht mehrere Erkrankungsarten verbergen. Er hat damit wesentlich dazu beigetragen, nach neuen Therapien zu suchen, die auf die individuelle Erkrankungsform zugeschnitten sind.
Preisträger 2009: Schizophrenie- und Depression-Forschung
Daniel R. Weinberger, der 1947 in New York geboren wurde, studierte Medizin an der Johns Hopkins University. Er erwarb 1973 seinen medizinischen Doktortitel (MD) an der University of Pennsylvania und durchlief danach eine zehnjährige Ausbildung in Innerer Medizin, Neurologie und Psychiatrie an den Schools of Medicine der University of California in Los Angeles (UCLA), der Harvard University und der Georg Washington University. 1977 übernahm er erstmals Aufgaben innerhalb der Forschungsprogramme des National Institute of Mental Health (NIMH). Seit 1998 ist er Chef der Abeilung "Clinical Brain Disorders Branch" und seit 2003 Direktor des weltweit hoch angesehenen "Gene, Cognition and Psychosis"-Programms, das sich vor allem der Erforschung der Schizophrenie verschrieben hat.
Weinberger forschte bereits über anatomische Hirnabnormitäten bei Schizophrenie-Patienten als die bildgebenden Verfahren für antomische Studien an lebenden Hirnen - sowohl von Gesunden als auch von Hirnkranken - noch in den Kinderschuhen steckten. Bereits früh in seiner wissenschaftlichen Laufbahn setzte sich Weinberger intensiv mit diesen Methoden auseinander und hat entscheidend zu deren Weiterentwicklung beigetragen.
So entdeckte er bei Schizophrenie-Patienten Anomalien des Hippocampus, die auf Reifungsstörungen hinweisen. Diese Struktur des menschlichen Gehirns zählt zu den ältesten in der Evolution und ist die zentrale Schaltstelle des limbischen Systems, das unter anderem Emotionen steuert. Diese neurobiologische Entwicklungsstörung bildet die pathophysiologische Grundlage schizophrener Psychosen, so die Hypothese Weinbergers.
Weinberger und sein Team haben darüber hinaus auch viele Gene identifiziert, die das Risiko für Schizophrenie beeinflussen. Darunter wahrscheinlich - so Weinberger in einem aktuellen Interview - erstmalig auch ein Gen, das einen wichtigen biologischen Faktor steuert. Dieser bestimmt möglicherweise die Schizophrenieanfälligkeit einer Person mit. Schizophrenie scheint sich somit immer mehr als eine genetisch determinierte Krankheit herauszustellen.
Florian Holsboer, der 1945 in München geboren wurde, habilitierte sich 1984 für das Fach Psychiatrie und Neuroendokrinologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Bereits 1989 berief ihn die Max-Planck-Gesellschaft als Direktor an das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Das Institut, das sich vor allem der Erforschung von Depressionen und Angsterkrankungen widmet, zählt zu den international führenden Einrichtungen auf diesem Gebiet. Die Basis des Erfolgs ist das von Holsboer vertretene Prinzip, Fragestellungen der Grundlagenforschung in der Klinik zu gewinnen. Die Erkenntnisse aus den Grundlagenlabors fließen dann erneut in die klinische Forschung ein.
So fand Florian Holsboer beispielsweise heraus, dass bei Patienten mit Depressionen das Neuropeptid CRH (Corticotropin-releasing Hormon) nicht nur an der Konzentrationserhöhung von Stresshormonen beteiligt ist, sondern maßgeblich zu den bei Depressionen typischen psychischen Symptomen führt. In seinen Labors untersuchte er mit biochemischen und molekulargenetischen Methoden die Regelsysteme für Stresshormone. Dabei zeigte sich, dass bei depressiven Patienten ein Rezeptor in seiner Funktion gestört ist, der für die adäquate Rückregulation des Stresshormonssystems im Gehirn verantwortlich ist. Darüber hinaus identifizierte Florian Holsboers Arbeit die besondere Relevanz eines CHR-Rezeptors, dessen Aktivierung wesentlich zu den depressionstypischen Symptomen beiträgt. Holsboers Idee war es, diesen Rezeptor gezielt zu blockieren. Daraus entwickelte sich ein neuer Therapieansatz für Depressions-Patienten.
Preisträger 2008: Hirntumor-Forschung
Professor David N. Louis wurde Ende 1959 in London geboren und ging auch dort zur Schule. Sein Studium absolvierte er in den USA - zunächst am Cornell University College of Arts and Sciences in Ihaka, New York, wo er als Hauptfächer Englisch sowie mittelalterliche Geschichte belegte und 1981 seinen Bachelor of Arts erwarb (mit magna cum laude). Dann wechselte er das Fach und studierte Medizin an der - zur State University of New York gehörenden - Stony Brook School of Medicine. 1985 wurde er dort zum Doktor der Medizin promoviert. Die anschließende Postdoc-Ausbildung absolvierte er zwischen 1985 und 1992 vor allem am Massachusetts General Hospital in Boston, Massachusetts, wo er unter anderem in der anatomischen Pathologie, der klinischen Neuropathologie und im Labor für molekulare Neuro-Onkologie arbeitete. Mitte der neunziger Jahre wurde er Professor für Pathologie an der Harvard Medical School in Boston und seit 2006 ist er Chefpathologe am Massachusetts General Hospital. Außerdem leitet er seit 2001 am dortigen Cancer-Center den Bereich molekulare Pathologie. Prof. Louis hat mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, darunter 1993 den Rubinstein Award der American Association of Neuropathologists for Best Paper on Neuro-Oncology, 1998 den Research Excellence Award der American Brain Tumor Association und 2004 den Hoshino Award der Japan Society for Neuro-Oncology.
Zentrales Forschungsthema von Prof. Louis sind die molekulargenetischen Grundlagen menschlicher Hirntumoren. Mit deren Kenntnis lassen sich auf diesem Gebiet neue diagnostische und therapeutische Ansätze entwickeln. Beides ist besonders wichtig, da maligne Hirntumoren - die oft schon bei Kindern auftreten und in diesem Alter die zweithäufigste bösartige Erkrankung sind - gerade jenes Organ zerstörend beeinflussen, das das "Selbst" des Menschen definiert.
Bei Erwachsenen gehört die Gruppe der Gliome zu den am meisten verbreiteten malignen Hirntumoren. Ihre Erforschung bildet deshalb einen Schwerpunkt im Labor von Prof. Louis. Unterarten dieser Gliome sind die besonders aggressiven Astrozytome, die Oligodendrogliome und die Oligoastrozytome. Welche spezifischen Charakteristika einzelne Gliom-Subtypen aufweisen, zeigten Prof. Louis und seine Mitarbeiter auf. So fanden sie heraus, dass die Astrozytome sowohl inaktivierende Mutationen des Tumorsuppressor-Gens TP53 aufweisen als auch eine übermäßige Expression des sogenannten PDGF-Faktors (platelet derived growth factor) - eines Wachtstumsfaktors, der an der Zellproliferation beteiligt ist. Ferner entdeckten sie, dass es mit fortschreitender Entwicklung des malignen Glioms zum Verlust von Chromosomen kommt. Das führt unter anderem zur Inaktivierung des PTEN Tumorsuppressorgens und zur Überexpression des Gens des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR).
Prof. Louis wies nach, dass eine molekulargenetische Analyse es möglich macht, klinisch relevante Untergruppen von Glioblastomen zu definieren: Zum Beispiel solche mit TP53-Mutation oder mit einer verstärkten Produktion von EGFR. Bei den ersteren handelt es sich häufig um Tumoren bei jüngeren Patienten, die sich zum Teil aus vorbestehenden niedriggradigen Astrozytomen entwickelt haben (sogenannte sekundäre Glioblastome). Eine EGFR-Amplifikation und verstärkte Expression ist hingegen typisch für sogenannte primäre Glioblastome, die ohne lange Vorgeschichte zumeist bei älteren Patienten auftreten.
Die Bestimmung molekulargenetischer Veränderungen, so Prof. Louis, eignet sich auch sehr gut für die Vorhersage, ob und wie Patienten mit bösartigen Oligendrogliomen auf eine Strahlen- und Chemotherapie reagieren und welche Überlebenschance sie haben. Vor allem bei Patienten, deren Tumoren einen Verlust des kurzen Arms von Chromosom 1 (1p) und des langen Arms von Chromosom 19 (19q) aufweisen, wirken Strahlen- oder Chemotherapie sehr gut und die Überlebenszeit der so Behandelten beträgt im Mittel mehr als zehn Jahre. Dagegen sprechen Patienten, deren Tumoren keine Verluste von 1p und 19q zeigen, nur selten dauerhaft auf die Therapie an und die mittlere Überlebenszeit dieser Patienten beträgt dann nur knapp zwei Jahre. Diese Ergebnisse haben schon zu klinischen Anwendungen geführt. In jüngster Zeit demonstrierten Prof. Louis und Mitarbeiter, dass die Erstellung von sogenannten Gen-Expressions-Profilen mittels moderner Mikroarray-basierter Methoden dazu genutzt werden kann, bösartige Gliome objektiver zu klassifizieren, als es die Standardpathologie vermag.
Prof. Darell D. Bigner wurde Anfang Dezember 1940 in Biloxi im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Nachdem er die High School in Brunswick, Georgia, absolviert hatte, besuchte er das College der University of Georgia, wo er 1962 den Bachelor of Science erwarb. Es folgte ein Medizinstudium an der Medical School des Medical College of Georgia und von 1963 bis 1971 an der Duke University in Durham, North Carolina. Dort erwarb er 1965 den M.D. und an der Graduate School (Division of Immunology) dieser Universität 1971 den Ph.D. Ausgebildet wurde er während seiner Postdoc-Zeit unter anderem in allgemeiner Chirurgie, medizinischer Neurologie, neurologischer Chirurgie sowie Pathologie und Neuropathologie. An der Duke University war er zwischen 1971 und 1975 Assistant Professor unter anderem in Neuropathologie und experimenteller Chirurgie. Während dieser Zeit weilte er auch mehrfach als Gast am Max-Planck-Institut für Hirnforschung (heute MPI für neurologische Forschung) in Köln. 1978 erhielt er einen Ruf als Professor für Pathologie an die Duke University. Seit 1984 ist er Direktor eines Forschungszentrums des NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) und seit 1987 Edwin L. Jones, Jr. and Lucille Finch Jones Cancer Research Professor of Pathology am Medical Center der Duke University. Er ist unter anderem Mitglied der American Association of Cancer Research, der American Association of Neuropathologists sowie der Society for Neuro-Oncology. Zu den zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen, die er erhielt, gehört der NCI Merit Award "Brain Tumors, Immunological and Biological Studies", der Faber Foundation Brain Tumor Research Award sowie der erste "Robert C. Bast, Jr., M.D. Leadership Award" des 'Duke Comprehensive Cancer Center'. Außerdem gehört Prof. Bigner seit 2007 als Ehrenmitglied der amerikanischen Gesellschaft für Neurochirurgie (AANS) an.
Prof. Bigners Labor ist die führende Einrichtung des Neuroonkologie-Programms der Duke Universität - ein Programm, das die Lücke zwischen Grundlagenforschung und klinischen Wissenschaften überbrücken will. Ziel der Forschungen ist es, die Basismechanismen der neoplastischen Transformation und die Mechanismen der veränderten Wachstumskontrolle in primären und metastatischen Hirntumoren aufzuklären. Wie sich die Ergebnisse später in Form besserer Diagnose- und Behandlungsmethoden umsetzen lassen, wird in präklinischen Studien untersucht.
Bigners eigene Forschungen der letzten 20 Jahre konzentrierten sich auf die gezielte Therapie von Tumoren des zentralen Nervensystems mithilfe monoklonaler Antikörper und davon abgeleiteter Antikörper-Fragmente. Die am weitesten fortgeschrittene Studie beschäftigt sich mit einem Molekül, das vor Jahren in Bigners Labor entdeckt wurde: das extrazelluläre Matrixmolekül Tenascin, das eine wichtige Funktion bei der Zellanheftung hat. Es ist in den meisten primären Hirntumoren und in vielen metastatischen Tumoren präsent, nicht aber im normalen Gehirn. Gegen dieses Molekül konnte ein radiomarkierter monoklonaler Antikörper hergestellt werden, der sich für eine gezielte Therapie eignet, wie vielversprechende Resultate in der klinischen Erprobung zeigten. Von diesem und anderen Antikörpern produzierten die Wissenschaftler mit molekulargenetischen Methoden kleinere Fragmente. Aus diesen ließen sich Immunotoxine herstellen, von denen ein wichtiges Zielmolekül eine tumorspezifische Mutante des epidermalen Wachstumfaktor-Rezeptors (die sogenannte EGFRvIII-Variante) ist.
Auch gegen andere Zielmoleküle, die nur auf bösartigen Hirntumoren vorkommen, wurden im Labor von Prof. Bigner neue spezifische und therapeutisch verwendbare monoklonale Antikörper entwickelt. An weiteren Therapieentwicklungen, wie etwa an der onkolytischen Virustherapie mit einem genetisch veränderten Poliovirus, war Bigners Labor ebenfalls beteiligt.
Preisträger 2007: Cochlea-Implantate und implantierbare neuromotoorischen Prothesen
Prof. Dr. John P. Donoghue wird ausgezeichnet für seine Forschungen zu der Frage, wie das Gehirn Gedanken in Handlungen umsetzt; die Aufklärung dieses Problems war Voraussetzung für die von ihm betriebene Entwicklung neuronaler Prothesen, die als Interface zwischen Gehirn und Maschine eingesetzt werden und gelähmte Patienten in die Lage versetzen sollen, Maschinen nur mit dem Willen zu steuern.
Prof. John P. Donoghue, 1949 geboren, studierte an den Universitäten von Boston (1971 Bachelor im Fach Biologie) und Vermont (1976 Master of Science im Fach Anatomie) und wurde 1979 an der Brown University in Providence mit einer Arbeit auf dem Gebiet der Neurowissenschaften promoviert. Anschließend arbeitete er als Postdoc am Department für Anatomie der Michigan State University (1979 bis 1980) und als NIH-Fellow am Labor für Neurophysiologie in Bethesda (1980 bis 1984).
Seit 1984 ist Donoghue an der Brown University in Providence tätig - als Assistant und später Associate Professor am Center for Neural Science sowie seit 1991 als Professor am Department of Neuroscience, das er bis 2006 leitete. Außerdem ist er seit 1998 Direktor des Brain Science Program an dieser Universität. Im Jahr 2001 war er Mitbegründer der Firma Cybernetics Neurotechnology Systems in Foxborough, Massachusetts. Donoghue, unter anderem Mitglied der New York Academy of Science, hat viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten - etwa 2002 den Javits Neuroscience Investigator Award der National Institutes of Health. Im Jahr 2004 wählte ihn das Wissenschafts-Magazin Discover zum Forscher des Jahres.
John P. Donoghue beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Frage, wie das Gehirn Gedanken in Handlungen umsetzt. Unter Einsatz von Multielektroden-Chips, die in die motorische Hirnrinde von Primaten implantiert wurden, konnte er die elektrischen Impulse multipler Nervenzellen über lange Zeiträume simultan registrieren. Aus der Korrelation der Aktivitätsmuster mit motorischen Handlungen gelang es ihm, die neuronale Kodierung der Handlungsabläufe zu entschlüsseln und durch Dekodierung dieser Signale willensabhängige Handlungen auf Maschinen zu übertragen. Die Richtigkeit dieses Konzepts konnte im Tierversuch nachgewiesen werden. Für die klinische Umsetzung wurden Hirn-Maschinen-Schnittstellen ("BrainGates") entwickelt, die ins Hirn gelähmter Patienten implantiert werden können und ihnen die Möglichkeit eröffnen sollen, Computer, Roboterarme oder sogar gelähmte Gliedmaßen über die Aktivität des eigenen Gehirns zu steuern.
Das BrainGate, eine von der Firma Cybernetics entwickelte Neuroprothese, besteht aus einem vier Millimeter im Quadrat großen elektronischen Chip, der 100 haarfeine Elektroden enthält und im Motorcortex implantiert wird - jenem Teil der Großhirnrinde, in dem durch Reize Bewegungen bestimmter Muskeln ausgelöst werden. Die Elektroden des Chips registrieren die elektrische Aktivität der Cortexzellen, die sich aufbaut, sobald der Wille vorliegt, eine gewisse Handlung zu initiieren. So ruft etwa die Absicht, die rechte Hand zu öffnen, ein für diesen Wunsch charakteristisches Aktivitätsmuster der Neuronen hervor. Dieses Muster wird von den Elektroden ausgelesen, decodiert und von einer Signal Processing Unit über Leitungen an eine rechtsseitige Armprothese weitergegeben. Ergebnis: Der Patient, obwohl völlig gelähmt, öffnet die Hand dieses künstlichen Arms.
Das System wurde erstmals im Sommer 2006 an einem 25-jährigen Patienten erprobt, der seit einer fünf Jahre zurückliegenden Messerattacke vom Hals an gelähmt war. Ihm gelang es mit dem System, allein durch Nachdenken über die für bestimmte Bewegungen relevanten Aktionen, den Cursor über den Bildschirm eines Computers zu lenken und damit etwa E-Mails abzurufen. Der Patient konnte den Fernseher einschalten und die Programme auswählen. Und er war in der Lage, Computerspiele zu spielen. Nach einigem Training vermochte er auch die Hand seiner Prothese zu öffnen oder zu schließen und auf diese Weise Objekte zu greifen und zu bewegen. Diese spektakulären Ergebnisse einer Übertragung willensabhängiger Handlungen vom Menschen auf Maschinen wurden im Juli 2006 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
Inzwischen arbeiten John P. Donoghue und sein Team an Verfeinerungen des BrainGate- Systems. Ihr langfristiges Ziel ist es, eine Hirn-Computer-Schnittstelle zu entwickeln, die es Gelähmten ermöglicht, wieder ihre eigenen Gliedmaßen zu bewegen.
Prof. Dr. Graeme M. Clark erhält die Auszeichnung in Anerkennung seiner bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Cochlea-Implantate zur Versorgung gehörloser Patienten; bei diesen Implantaten handelt es sich um die ersten Neuroprothesen, die beim Menschen zum Einsatz kamen.
Prof. Graeme M. Clark, 1935 in Camden, New South Wales, geboren, studierte in Australien und England Medizin, spezialisierte sich auf den Gebieten Allgemeine Chirurgie und Pathologie sowie später Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und schloss das Studium 1968 an der Universität Sydney mit dem Master in Chirurgie ab. Im Jahr 1969 wurde er mit einer Arbeit über neuronale Mechanismen des Hörens zum Dr. phil. promoviert. Im darauffolgenden Jahr berief ihn die Universität Melbourne zum Professor und Leiter des Departments für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Hier etablierte er sein erstes Cochlear Implant Program. 14 Jahre später gründete er das Bionic Ear Institute Australia und 1985 die Cochlear Implant Clinic am Eye & Ear Hospital.
Zwischen 1971 und 2002 war Clark Chiefinvestigator in 17 nationalen australischen Forschungsprojekten, die sich mit der elektrischen Stimulation des inneren Ohres und mit Chochlea-Prothesen für Gehörlose befassten. Clark ist mehrfacher Ehrendoktor, darunter seit 1988 an der Medizinischen Hochschule Hannover, Träger vieler nationaler und internationaler Auszeichnungen sowie unter anderem Mitglied der Royal Society London und der Australian Academy of Science.
Dass sich Graeme M. Clark schon früh als Forschungsgebiet die Gehörlosigkeit aussuchte, ist sicher mit auf die Taubheit seines Vaters zurückzuführen. Im Lauf seiner Untersuchungen gewann Clark die Überzeugung, das Hören von Sprache müsse sich wiederherstellen lassen, wenn es gelänge, das zerstörte oder nicht entwickelte innere Ohr zu umgehen und die Hörnerven direkt elektrisch zu stimulieren. Ausgehend von tierexperimentellen Untersuchungen erkannte Clark, dass für die Übermittlung sprachrelevanter Schallfrequenzen mehrere Elektroden erforderlich sind, um die verschiedenen Frequenzregionen der Cochlea - der Schnecke des Innenohres - zu aktivieren.
Dafür musste man implantierbare Multikanal-Elektroden entwickeln, die von Sprachprozessoren gesteuert werden, welche die für das Sprachverstehen relevanten Schallfrequenzen in elektrische Impulse umwandeln. Wie man solche Elektrodenbündel zu der Frequenzregion führen kann, ohne die Cochlea zu verletzen, hatte Clark zuvor an Seemuscheln geübt. Und er hatte sich auch vergewissert, dass der Eingriff nicht gerade zum Verlust der Fasern jener Hörnerven führt, die man zu stimulieren hoffte.
Im Jahr 1978 gelang es Graeme M. Clark erstmals, mit einem solchen Implantat das Sprachverstehen eines ertaubten Erwachsenen wiederherzustellen. Und seit 1985 werden auch taub geborene Kinder mit Cochlea-Implantaten versorgt, um ihnen das Hören und damit die aktive Generierung von Sprache zu ermöglichen. Inzwischen tragen weltweit bis zu 200.000 gehörlose Patienten Cochlea-Implantate - und viele von ihnen können mit diesen Neuroprothesen ein weitgehend normales Leben führen.
Preisträger 2006
Prof. Dr. Peter J. Jannetta erhält den Preis "in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Untersuchungen zum Konzept der neurovaskulären Kompression und den daraus abgeleiteten Operationsverfahren zur Behandlung der Trigeminus-Neuralgie und anderer neurovaskulärer Kompressionssyndrome".
Professor Peter Joseph Jannetta, Jahrgang 1932, graduierte an der University of Pennsylvania, Philadelphia, im Fach Zoologie und absolvierte an der dortigen School of Medicine auch sein Studium im Fach Chirurgie, das er 1957 mit der Promotion abschloss. Anschließend ermöglichte ihm ein Stipendium des National Institute of Health einen Forschungsaufenthalt in der Neurophysiologie der University of California, Los Angeles, an der er danach als Assistenzarzt tätig war. 1966 wurde er als Professor und Leiter der Abteilung Neurochirurgie an das Medical Center der Lousiana State University, New Orleans, berufen. 1971 wechselte er an die School of Medicine der University of Pittsburgh, wo er die Leitung der Neurochirurgie übernahm. Nach 29 Jahren an dieser Unversität wurde er im Juli 2000 Vice-Chairman am Allegheny General Hospital in Pittsburgh und Leiter des dortigen Departments für Neurochirurgie. Gleichzeitig erhielt er eine Professur für Neurochirurgie am College of Medicine der Drexel University in Pittsburgh. Jannetta ist Mitglied vieler nationaler und internationaler Akademien, erhielt zahlreiche hohe Auszeichnungen, darunter im Jahr 2000 den Dr. Fritz Erler Preis für Internationale Chirurgie der Universität Nürnberg-Erlangen.
Zu den herausragenden wissenschaftlichen Leistungen Jannettas zählt die Erarbeitung eines Konzepts des neurovaskulären Konflikts bzw. der neuronalen Kompression von Hirnnerven, die zu unterschiedlichen Erkrankungen führen kann: Durch die Schädigung dieser Nerven werden unter anderem die motorischen Funktionen von Zunge, Augen und Gesichtsmuskeln beeinträchtigt. Das bekannteste Syndrom ist die Trigeminus-Neuralgie (TGN), ein chronischer Zustand heftigster Schmerzen von Wangen, Lippen, Zahnfleisch oder Kinn einer Gesichtshälfte. Als Ursache der Trigeminus-Neuralgie identifizierte Jannetta eine Kompression des 5. Hirnnervs - des Trigeminus-Nerven - durch umgebende Blutgefäße. Jannetta entwickelte anhand dieses theoretischen Konzepts ein mikrovaskuläres Dekompressionsverfahren, das den Patienten eine effektive therapeutische Alternative eröffnet, wenn medikamentöse Behandlungen versagen. Bei der mikrovaskulären Dekompression handelt es sich um einen mikrochirurgischen Eingriff, der eine kleine Öffnung des Schädels hinter dem Ohr erforderlich macht. Durch diese Öffnung kann der Trigeminus-Nerv überprüft und gegebenenfalls die ihn drückende Arterie rückverlagert oder durch Platzierung eines schützenden Kissens zwischen Nerv und Arterie beiseite geschoben werden. Handelt es sich bei dem Druck ausübenden Gefäß um eine Vene, so geht man in ähnlicher Weise vor oder entfernt sie operativ. Durch diesen Eingriff lassen sich die halbseitigen heftigen Schmerzen im Gesicht und im Zungen-Schlund-Bereich stoppen – Störungen, die übrigens auch die Geschmacksfähigkeit des Patienten beeinträchtigten.
Die gegenwärtigen Forschungsbemühungen dieses innovativen Denkers der Neurochirurgie konzentrieren sich darauf, die Wirksamkeit der Gefäß-Dekompression bei der Behandlung von Schwindel und Tinnitus (Ohrgeräuschen) zu überprüfen. Außerdem untersucht er, ob der neurovaskuläre Konflikt auch bei Patienten mit essentiellem Bluthochdruck, mit Funktionsstörungen des Herzens oder mit endokrinen Problemen (zum Beispiel Diabetes) nicht auch eine Rolle spielt.
Der inzwischen "Jannetta-Operation" genannte Eingriff ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass ein theoretisches Konzept bei konsequenter Umsetzung zu einem operativen Verfahren führen kann, mit dem abertausende Patienten von chronischen Schmerzen und halbseitigen Gesichtsspasmen befreit werden konnten. Und dessen Potential möglicherweise - wenn sich Jannettas Vermutungen bewahrheiten - noch keineswegs ausgeschöpft ist.
Prof. David Julius wird ausgezeichnet "in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Entdeckungen auf dem Gebiet der Schmerzforschung, insbesondere der Aufklärung der molekularen Mechanismen der Schmerz- und Temperaturempfindung".
Professor David Julius, Jahrgang 1955, studierte zunächst am Massachusetts Institute of Technology und erwarb hier 1977 den Bachelor in Life Sciences. Anschließend setzte er sein Studium am Department of Biochemistry der University of California, Berkeley, fort, wo er 1984 zum Ph.D. promoviert wurde. Danach arbeitete er bis 1990 als Postdoctoral Fellow am Institute of Cancer Research der Columbia University, New York, und seit 1990 ist er am Department of Cellular and Molecular Pharmacology der University of California, San Francisco, tätig, zunächst als Assistent und seit 1999 als Professor. Prof Julius ist Träger vieler hoher Auszeichnungen und Mitglied nationaler und internationaler Akademien.
In seinem Festvortrag "Vom Pfeffer zum Pfefferminz – Aufklärung molekularer Mechanismen der Schmerzwahrnehmung und Schmerzempfindung", den Prof. Julius anlässlich der Zülch-Preis-Verleihung hält, berichtet er, dass es seinem Forscherteam darum gehe, die neuralen Mechanismen aufzuklären, die unserem Tastsinn zugrunde liegen – einschließlich seiner Fähigkeit, Temperatur- und Druckänderungen zu spüren. Das spezielle Interesse der Forscher gelte der Frage, wie diese Mechanismen dazu beitragen, dass wir schmerzvolle Stimuli wahrzunehmen in der Lage sind (Nozizeption). Um das zu erkunden, habe man die Fähigkeit natürlicher Produkte genutzt, molekulare Prozesse der Schmerzwahrnehmung und -empfindung auszulösen. Zum Beispiel sei man der Frage nachgegangen, wie das Capsaicin, der wichtigste Schärfe-Bestandteil der Peperoni, einen brennenden Schmerz hervorruft, und wie Menthol, das kühlende Agens in Pfefferminzblättern, zu einer Empfindung von Eiseskälte führt. Diese Bestandteile seien als pharmakologische Sonden genutzt worden, um damit spezifische Moleküle (Ionenkanäle an sensorischen Nervenfasern) zu identifizieren, die durch Hitze oder Kälte aktiviert werden. Mit Hilfe genetischer und elektrophysiologischer Methoden sowie Verfahren der Verhaltensforschung habe man dann untersucht, wie diese Ionenkanäle an der Wahrnehmung von Hitze oder Kälte mitwirken.
Sein Team versuche außerdem zu verstehen, auf welche Weise sich Schmerz als Reaktion auf jene Gewebe- oder Nervenschädigungen verstärkt, die mit wachsenden Tumoren, Infektionen oder anderen Formen von Verletzungen einhergehen. Sie rufen Entzündungen hervor und führen zu Schmerzüberempfindlichkeit. Wichtig sei dabei vor allem die Frage gewesen, ob und wie die „Entzündungsagenten“, die zu dieser Überempfindlichkeit beitragen, die neu identifizierten Ionenkanäle modifizieren.
Diese Arbeiten, so das einhellige Urteil, haben die Schmerzforschung revolutioniert und tragen sicher zur Entwicklung neuer Medikamente für die klinische Behandlung chronischer Schmerzen bei.
Preisträger 2005
Prof. Dr. Christian Elger wird ausgezeichnet für seine herausragenden wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gebiet der experimentellen Epilepsieforschung und deren Übertragung auf die klinische Epileptologie.
Prof. Dr. Christian E. Elger, Jahrgang 1949, absolvierte nach dem Abitur zunächst ein Praktikum bei dem Theaterregisseur Peter Palitsch in Stuttgart, studierte dann ein Semester Biologie und Chemie in Tübingen und nahm 1969 das Studium der Humanmedizin an der Universität Münster auf. Nach seiner Approbation als Arzt (1976) war er hier bis 1982 wissenschaftlicher Assistent am Physiologischen Institut, wurde 1978 zum Dr. med. promoviert und habilitierte sich vier Jahre später für das Fach Physiologie. Bis 1985 erhielt er in Münster, Memphis (USA) und Zürich eine Ausbildung zum Arzt für Neurologie und habilitierte sich 1986 auch für dieses Fach.
Seit 1987 ist Christian Elger Professor für Epileptologie an der Universität Bonn und seit Ende 1990 Direktor der Bonner Universitätsklinik für Epileptologie. Hier baute er ein Team auf, das intensive Grundlagenforschung betreibt und die Kriterien für eine Differenzierung zwischen pharmakologischer und operativer Epilepsiebehandlung erstellt.
Elger selbst arbeitet nicht chirurgisch, sondern konzentriert sich auf die aufwändige Diagnostik, die der operativen Behandlung vorausgeht. Von 1997 bis 1999 war er Vorsitzender der Deutschen Liga gegen Epilepsie und von 2000 bis 2001 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie. Zusammen mit sieben deutschen Kollegen rief er im Jahr 2000 das "Jahrzehnt des menschlichen Gehirns" aus - als Fortsetzung der amerikanischen "Decade of the brain". Seit 1999 ist Elger Fellow of the Royal College of Physicians in London und seit 2000 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften.
Sein Festvortrag anlässlich der Verleihung des Zülch-Preises trägt den Titel "Epilepsie - Erkrankung und Modell zur Untersuchung des menschlichen Gehirns". Mit etwa 600.000 Betroffenen ist die Epilepsie die zweithäufigste neurologische Erkrankung in Deutschland. In der Regel lässt sie sich gut behandeln: Etwa zwei Drittel aller Patienten profitierten derart von einer medikamentösen Therapie, dass sie ein weit gehend normales Leben ohne Anfälle zu führen vermögen. Das restliche Drittel der Patienten ist jedoch mehr oder weniger pharmakoresistent. In dieser Gruppe gibt es laut Christian Elger zahlreiche Fälle, die von einem epilepsiechirurgischen Eingriff - der operativen Entfernung eines Epilepsieherdes im Gehirn - so profitieren können, dass sie nach der Operation dauerhaft anfallsfrei sind.
Voraussetzung für eine solche Operation sei aber eine aufwändige prächirurgische Epilepsiediagnostik. Zum Beispiel müssten bei einem Teil der OP-Kandidaten Elektroden in das Gehirn eingebracht werden, um einen Epilepsieherd, der sich in erster Linie durch krankhafte elektrische Entladungen der Nervenzellen bemerkbar macht, so exakt zu lokalisieren, dass ein späterer resektiver Eingriff möglichst schonend vorgenommen werden kann.
Studien im Umfeld dieser prächirurgischen Epilepsiediagnostik haben laut Elger erstaunliche Befunde über die Prozesse erbracht, die der deklarativen Gedächtnisbildung, das heißt der Speicherung und dem Abruf von abstraktem Wissen und persönlichen Erinnerungen, zu Grunde liegen. Und sie hätten es ermöglicht, das faszinierende Phänomen der Plastizität des Gehirns zu untersuchen, also die Übernahme von Funktionen einer geschädigten Hirnhemisphäre durch eine andere. Elgers Fazit: "Viele wichtige Fragen rund um das menschliche Gehirn lassen sich im Umfeld der prächirurgischen Epilepsiediagnostik optimal bearbeiten".
Prof. Dr. Samuel Berkovic erhält den Preis in Anerkennung seiner bahnbrechenden Untersuchungen über die genetischen Grundlagen der Epilepsie, insbesondere deren Verursachung durch Störungen von Ionenkanälen.
Prof. Dr. Samuel F. Berkovic, 1953 in Melbourne geboren, studierte Medizin an der dortigen Universität und wurde im Jahr 1985 promoviert. Anschließend war er Research Fellow am Montreal Neurological Institute in Kanada und an der University of Melbourne. Seit 1987 arbeitet er als Neurologe am Austin Hospital in Melbourne, außerdem ist er Professor am Department of Medicine und Direktor des Epilepsy Research Centre der Melbourne University.
Viele wissenschaftliche Gesellschaften und Akademien, darunter die American Academy of Neurology und die Australien Academy of Science, zählen Samuel Berkovic zu ihren Mitgliedern oder Fellows. Der Forscher ist Träger hoher Auszeichnungen, so des Epilepsy Research Recognition Award der American Epilepsy Society (1995), des Novartis Prize for Epilepsy Research (2001) und des GlaxoSmithKline Australia Award for Research Excellence (2002).
Schon seit Hippokrates, so Samuel Berkovic in seinem Festvortrag "Epilepsy Genetics - Learning from patients to solve mysteries", ist bekannt, dass Epilepsie eine erbliche Komponente enthält. In jüngster Zeit sei es seinem Team und anderen Gruppen gelungen, die Natur dieser Erbfaktoren aufzuklären. Dabei arbeiteten klinische Forscher, Patienten - vorwiegend Zwillinge oder Familien, bei denen Epilepsiefälle gehäuft auftraten - und Molekulargenetiker eng zusammen. Das Ergebnis dieser Kooperation führte zu wertvollen Einsichten in die Natur der Epilepsien.
So fanden die Wissenschaftler heraus, dass bestimmte Formen der Epilepsie durch vererbte Störungen von Ionenkanälen ausgelöst werden. Ionenkanäle sind Proteine, die an der Zelloberfläche sitzen und den Fluss von Ionen (Salzen) in die Zelle oder aus ihr heraus regeln. Als Ursache von Epilepsien wurden Störungen derartiger Ionenkanäle identifiziert - und zwar sowohl solcher, die auf die elektrischen Bedingungen der Hirnzellen reagieren, als auch solcher, deren Reaktion von der Bindung chemischer Botenstoffe zwischen den Zellen abhängt. Im Jahr 1995 lokalisierte das Team von Berkovic sogar erstmals ein Gen, dessen Mutation zu Störungen in den Ionenkanälen führt. Inzwischen haben Forscher weitere derartige Gene aufgespürt, viele von ihnen unter Mitarbeit der Melbourner Gruppe.
Allerdings sind viele Rätsel der Epilepsien noch ungelöst. Warum zum Beispiel wachsen Kinder oft aus der Epilepsie heraus, das heißt, warum treten solche Anfälle erstmals in einem bestimmten Alter auf und verschwinden später wieder, obwohl die genetische Abnormität weiterhin besteht? Die Erforschung der Ionenkanal-Funktion führt hier zu ersten Antworten auf solche Fragen. Die neuen Erkenntnisse ermöglichen es Samuel Berkovic zufolge, Patienten und Familien mit bisher unerklärlichen Epilepsieformen genetisch zu beraten. Und sie wecken außerdem die Hoffnung, in naher Zukunft neue und bessere Behandlungsformen zu entwickeln.
Preisträger 2004
Prof. Dr. Nikos K. Logothetis erhält die Auszeichnung für seine grundlegenden wissenschaftlichen Beiträge zur funktionellen Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT). Durch die Aufklärung der funktionellen Grundlagen des BOLD (Blood Oxygen Level Dependent)-Kontrastes gelang es ihm, Aktivitäten neuronaler Zellverbände mit hoher räumlicher Auflösung sichtbar zu machen.
Prof. Nikos K. Logothetis, Jahrgang 1950, ist griechischer Staatsbürger. Er studierte Mathematik (Diplom 1977) und Musik (Theorie und Klavier) in Athen sowie Biologie in Thessaloniki (Diplom 1980) und in München. An der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität wurde er 1985 in Human-Neurobiologie promoviert. Von 1985 bis 1990 arbeitete er als Postdoc und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Brain and Cognitive Science Institute des MIT in Cambridge, USA. 1990 wurde er Associate Professor und 1994 Professor am Baylor College of Medicine in Houston, USA. 1996 schließlich berief die Max-Planck-Gesellschaft Logothetis als Wissenschaftliches Mitglied und Direktor der Abteilung für Physiologie kognitiver Prozesse an das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Zu den hohen Auszeichnungen, die ihm verliehen wurden, gehörten der DeBakey Award for Excellence in Science (1996) und der Louis-Jeantet Preis für Medizin (2003).
Logothetis kombiniert unterschiedliche Untersuchungsverfahren miteinander, um immer tiefere Einblicke in das neuronale Hirngeschehen gewinnen zu können. Zwar liefert die bildgebende funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie unter Nutzung der BOLD-Kontraste eine Fülle von Informationen über das Primatenhirn, doch wirft sie auch immer neue Fragen auf. Um sie beantworten zu können, muss die neuronale Organisation des Hirns auf einem Niveau erforscht werden, das mit dieser Technik allein nicht zu erreichen ist - elektrophysiologische, histologische, neurochemische, spektroskopische Verfahren und Methoden der molekularen Bildgebung müssen hinzukommen. In seinem Vortrag anlässlich der Verleihung des Zülch-Preises beschreibt Logothetis die multimodale Methodologie, die er bei seinen Versuchen mit Affen eingesetzt hat und die es ermöglichten, Hirnstrukturen bis in den Millimeterbereich aufzulösen.
Mit einer solchen Methodenkombination gelang Logothetis und Mitarbeitern 2001 ein entscheidender Durchbruch: Sie konnten klären, welche neuronalen Aktivitäten durch die fMRT-BOLD-Messungen eigentlich wiedergegeben werden. Bei diesem Verfahren werden die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von arteriellem, sauerstoffreichem und venösem, sauerstoffarmem Blut dazu genutzt, im Hirngewebe die Veränderungen des Blutes zu messen, die durch eine erhöhte Neuronenaktivität ausgelöst werden. Dabei blieb allerdings ungeklärt, ob diese Änderungen auftreten, wenn die Neuronen "feuern", d.h. ein Ausgangssignal aussenden, oder wenn sie aus anderen Hirnregionen Eingangsignale empfangen und verarbeiten. Eine Klärung dieser Frage durch zeitgleiche elektrophysiologische Messungen schien unmöglich, da sich zum Beispiel die Elektrodenableitung aus den Zellen und das Magnet-Resonanz-Verfahren gegenseitig stark beeinflussen. Dieses Manko konnte das Tübinger Team jedoch durch Verwendung von Spezialelektroden und mit Hilfe einer ausgeklügelten Datenverarbeitung beseitigen, so dass sich jetzt beide Methoden gleichzeitig im Tierversuch anwenden lassen. Ein Vergleich der dabei gewonnenen Messdaten führte zu der Erkenntnis, dass das fMRT-BOLD-Bild nicht das Ausgangssignal der Nervenzellen, d.h. die neuronale Aktivität, widerspiegelt, sondern vorwiegend von dem Eingangssignal und dessen lokaler Verarbeitung bestimmt wird (s. MPG-Pressemitteilung 47 /2001 vom 11. Juli 2001 [1]).
Prof. Dr. Richard R.S. Frackowiak wird ausgezeichnet für seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Entwicklung und den Einsatz bildgebender Messverfahren zur Untersuchung kognitiver Leistungen des menschlichen Gehirns. Die von ihm entwickelten Standardisierungsmethoden der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) eröffneten den Einsatz dieser Techniken für die vergleichende Untersuchung komplexer Funktionsabläufe.
Professor Richard R.S. Frackowiak, Jahrgang 1950, ging in London zur Schule, studierte Medizin an der Cambridge University und wurde 1983 mit einer - an der MRC-Cyclotron Unit des Hammersmith Hospital in London angefertigten - Arbeit über die quantitative Messung des cerebralen Blutflusses mit Hilfe der Positronen-Emissions-Tomographie zum Doktor der Medizin promoviert. Ein 1980 von ihm zu diesem Thema veröffentlichter Artikel war ein Jahrzehnt lang die am häufigsten zitierte Publikation auf dem Gebiet des Computereinsatzes in Biologie und Medizin. Die wichtigsten Stationen seiner weiteren wissenschaftlichen Laufbahn: Von 1988 bis 1993 leitete Frackowiak die neurologische Abteilung am Hammersmith Hospital, 1990 wurde er Professor für Neurologie, 1994 übernahm er die Leitung des Welcome Departments für bildgebende Neurowissenschaften am University College London (UCL), 1998 wurde er Direktor des Instituts für Neurologie am UCL und seit 2002 ist er stellvertretender Vorstand dieses Colleges. Frackowiak erhielt hohe wissenschaftliche Auszeichnungen, darunter den Wilhelm Feldberg Foundation Prize (1996) und den Foundation Ipsen Prize (1997).
Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere hatte sich Frackowiak zunächst mit der Untersuchung pathophysiologischer Veränderungen bei unterschiedlichen neurologischen Erkrankungen beschäftigt. Seine damaligen Arbeiten legten wichtige Grundlagen für die klinische Anwendung der Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Anfang der 90er Jahre wandte er sich dann zunehmend Aktivierungsstudien zur Darstellung von Hirnfunktionen zu. Diese systematisch ausgebauten Untersuchungen verschafften Frackowiaks Arbeitsgruppe bald eine weltweit führende Position auf dem Gebiet der funktionellen Hirnlokalisation. Die bevorzugte Methode bei solchen Forschungen war die funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT), die ohne Strahlenbelastung auskommt und sowohl strukturelle als auch funktionelle Bilder hoher räumlicher Auflösung liefert. In seinem Vortrag über "die funktionale Architektur des menschlichen Gehirns", den Frackowiak anlässlich der Preisverleihung hält, beschreibt er, wie der - automatisierte - Prozess der Bilderzeugung und -analyse so standardisiert werden konnte, dass sich seine Ergebnisse zur Anfertigung struktureller und funktioneller Hirnkarten nutzen lassen. Die aufregendste und dramatischste Erkenntnis aus solchen Karten sei die dynamische Plastizität in Funktion und Struktur, die sowohl normale Gehirne als auch solche von Patienten mit neurologischen und neuropsychiatrischen Störungen aufweisen. Neuere Studien erbrachten inzwischen interessante Informationen über die Fähigkeit des Hirns, sich nach Verletzungen und in Verbindung mit Üben und Lernen zu reorganisieren.
Preisträger 2003
Prof. Katsuhiko Mikoshiba wird ausgezeichnet für seine Beiträge über die intrazellulären Signalmechanismen der Calcium-Homöostase und speziell für die Entdeckung des IP3-Rezeptors in den Purkinjezellen.
Prof. Katsuhiko Mikoshiba, 1945 in Nagano/Japan geboren, studierte an der Keio University, an der er 1969 seinen Doktorgrad in Medizin erwarb und vier Jahre später auch zum Doctor of Medical Science (PhD) promoviert wurde. Von 1974 bis 1985 war er Assistant bzw. Associate Professor am Department of Physiologie an der Keio University School of Medicine - 1976/77 unterbrochen durch einen Forschungsaufenthalt am Pasteur Institut in Paris. Es schloss sich eine Professur an der Division of Regulation of Macromolecular Function, Institute for Protein Research, der Osaka University an (1985-1992). 1992 wurde Mikoshiba Chief Scientist am Labor für molekulare Neurobiologie des Riken-Instituts - eine Position, die er bis 1997 inne hatte (seither ist er dort noch Teamleiter am Laboratory for Developmental Neurobiology) und gleichzeitig wurde er an das Department of Molecular Neurobiology, Institute of Medical Science, der Universität Tokyo berufen, an der er bis heute tätig ist. Seit 1995 leitet er außerdem das Mikoshiba Calciosignal Net Project der Research Corporation of Japan und seit 2001 ist er Forschungsdirektor des Calcium Oscillation Project der Japan Science and Technology Corporation. Mikoshiba wurde mit vielen nationalen und internationalen Auszeichnungen und Ehrungen bedacht, darunter zweimal (1996 und 1999) mit dem Human Frontier Science Program Grant Award. Und 2000 wurde er vom American Biographical Institute zum "Man of the Year" erkoren.
Mikoshibas Forschungen konzentrieren sich auf das im menschlichen Körper am reichlichsten vorhandene Metall: das Calcium. Grosse Mengen Calcium sind in den Knochen gespeichert, aus denen unser Skelett aufgebaut ist. Das hier ausgefällte Calcium steht im Gleichgewicht mit den Calciumionen im Gefäßsystem des Blutkreislaufs. Es gilt heute als erwiesen, dass Calciumionen (Ca2+) eine wichtige Rolle spielen für die physiologischen Funktionen der Zelle.
Die Ca2+-Konzentration außerhalb der Zelle ist 10 000 Mal so groß wie die des intrazellulären Ca2+. Nach traditionellen Vorstellungen kontrolliert die Plasmamembran einer Zelle vollständig den Ca2+-Durchgang Ca2+ darf nur dann in die Zelle eintreten, wenn dort ein Bedarf besteht. Neuere Forschungen zeigten jedoch, dass Ca2+ nicht nur von außen reguliert wird, sondern dass es auch eine interne Speicherregion gibt, die große Mengen an Ca2+ enthält. Die von der Zelloberfläche erkannten Signale werden in einen sekundären Botenstoff (second messenger) umgewandelt und an das Zytoplasma abgegeben. Als sekundären Botenstoff, der die Ca2+-Freisetzung aus dem zellinternen Speicher veranlasst, identifizierte man Inositoltriphosphat (IP3). Die Konsequenz aus dieser Entdeckung war die hypothetische Annahme, es müsse einen IP3-Rezeptor geben ein Molekül , das an der Ca2+-Freisetzung beteiligt ist. Viele Forscher haben versucht, die molekulare Natur dieses postulierten IP3-Rezeptors aufzuklären.
Es waren Mikoshiba und sein Team, die schließlich Ende der 1980er Jahre herausfanden, dass es sich bei dem IP3-Rezeptor um ein Protein mit hohem Molekulargewicht handelt. Beim Vergleich der Gehirne von Mausmutanten, die Abnormalitäten im Verhalten und in der Gestaltbildung (Morphogenese) aufwiesen, mit den Gehirnen normaler Tiere stellten sie fest, dass in den Purkinjezellen des Kleinhirns degenerierter Mäuse ein Mangel an diesem Protein P 400 herrscht. Das Protein wurde daraufhin analysiert und entpuppte sich als der IP3-Rezeptor es handelt sich um einen Calciumionen-Kanal, der involviert ist in die Freisetzung von Ca2+ aus den intrazellulären Speichern. Die Forscher klonten und identifizierten die vollständige Primärstruktur der cDNA dieses IP3-Rezeptors und entdeckten, dass das Ca2+ intrazellulär im glatten endoplasmatischen Retikulum einem wesentlichen Bestandteil im Plasma insbesondere von Drüsen-, Nerven- und Embryonalzellen gespeichert ist.
Alle Körperzellen zeigen sehr langsame Calcium-Oszillationen, die essentiell für die Zellfunktion sind. Mikoshiba und Mitarbeiter stellten fest, dass der IP3-Rezeptor eine wichtige Rolle spielt bei der Erzeugung dieser sehr langsamen Ca2+-Oszillationen im Inneren der Zelle. Die vielen einzigartigen molekularen Eigenschaften des IP3-Rezeptors, die ihn von anderen Calciumkanälen in der Plasmamembran unterscheiden, können zum Verständnis der molekularen Mechanismen dieser Calciumoszillationen beitragen.
Um herauszufinden, zu welchen Störungen ein Mangel an IP3 induzierter Ca2+-Freisetzung führt, wurde ein die Ca2+-Freisetzung hemmender monoklonaler Antikörper hergestellt und gesunden Tieren injiziert. Anschließend beobachteten die Forscher die Entwicklung dieser Tiere und zogen daraus Rückschlüsse auf die Funktion des IP3-Rezeptors. Zu den dabei gewonnen Erkenntnissen gehört, dass - der IP3-Rezeptor eine bedeutsame Rolle spielt bei der Befruchtung sowie bei Zellteilungsschritten wie Reifeteilung (Meiose) und Verteilung je eines vollständigen Chromosomensatzes auf die neuen Tochterzellen (Mitose), - ein aktives Ca2+-Freisetzungssignal wichtig ist für die Festsetzung der zum Rücken hin (dorsal) und bauchwärts (ventral) gerichteten Achsenbildung während der frühen Körperentwicklung, - der IP3-Rezeptor bedeutsam ist für die normale Entwicklung der Gehirnfunktion - Mäuse mit einem IP3-Rezeptor-Mangel zeigen epileptische Anfälle sowie Kleinhirnataxie (Störung der willkürlichen Bewegungsabläufe, Tremor), - der IP3-Rezeptor stark involviert ist in die neuronale Plastizität des Gehirns. So wird z.B. im Kleinhirn von Mäusen mit IP3-Rezeptor-Mangel die an der Gedächtnisbildung beteiligte Long term Depression (LTD) unterdrückt.
Prof. Fred H. Gage erhält die Auszeichnung für seine Arbeiten auf dem Gebiet der neuronalen Stammzell- und Gehirnreparationsforschung sowie für seine Studien zur Neurogenese im erwachsenen Zentralnervensystem, die unser Verständnis der Hirnplastizität revolutioniert haben.
Prof. Fred H. Gage, 1950 in den USA geboren, studierte Medizin - zunächst an der University of Florida in Gainsville, wo er 1972 seinen Bachelor of Science erwarb. 1974 ging er als Predoctoral Fellow an die Johns Hopkins University in Baltimore, an der er 1976 im Fach Neurowissenschaften promoviert wurde. Zwischen 1976 und 1988 hatte er Associate Professuren inne an der Texas Christian University, am Department of Histology der Universität Lund in Schweden und am Department of Neurosciences der University of California in La Jolla. Seit Mitte 1988 ist er Professor an diesem Department und seit 1995 auch am Laboratory of Genetics des Salk Institute for Biological Studies. Gage wurde mit vielen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, darunter dem Bristol-Myers Squibb Neuroscience Research Award (1987), dem IPSEN Prize in Neuronal Plasticity (1990) sowie dem Max-Planck-Forschungspreis (1999) - und er gehört seit 2001 dem Institute of Medicine der National Academy of Sciences als Mitglied an.
Prof. Gage hat im Verlauf von zwei Jahrzehnten bahnbrechende Arbeiten auf den Gebieten Neuroregeneration und Neurotransplantation im Zentralnervensystem vorgelegt. Von besonderer Bedeutung ist seine Entdeckung multipotenter Stammzellen im Gehirn und im Rückenmark erwachsener Säugetiere. Die meisten Neurone im erwachsenen Zentralnervensystem sind vollständig ausdifferenziert und werden nach ihrem Absterben nicht ersetzt. Daraus resultierte das alte Dogma der Neurobiologie, wonach geschädigte oder abgestorbene Zellen im erwachsenen, "fertigen" Hirn generell nicht durch neue Zellen ausgewechselt oder regeneriert werden.
Gage und seine Mitarbeiter konnten dieses Dogma entkräften: Sie fanden heraus, dass im erwachsenen Riechhirn (dem "Riechkolben") und im Hippocampus eine zwar geringe, doch stetige Neubildung von Neuronen stattfindet. Die Stammzellen, aus denen diese neuen Hirnzellen entstehen, entdeckten die Wissenschaftler im Gebiet des so genannten Gyrus Dentatus, einer Region des Hippocampus. Nachkommen dieser Stammzellen differenzieren innerhalb eines Monats nach der Zellgeburt zu Neuronen. Diese späte Neurogenese hält während des ganzen Lebens eines Säugetieres an.
Man kann multipotente Stammzellen in einer Vielzahl von Gehirn- und Rückenmarkregionen "ernten", kann sie genetisch modifizieren und zurück ins Hirn oder Rückenmark transplantieren, wo sie sich dann abhängig von der lokalen Umgebung zu reifen Gliazellen oder zu Neuronen entwickeln. Außerdem beeinflusst eine stimulierende Umwelt auch Vermehrung, Wanderung und Ausdifferenzierung dieser Zellen im lebenden Organismus. Gage und seine Mitarbeiter untersuchten sowohl die molekularen und zellulären als auch die von der Umwelt herrührenden Faktoren, welche die Zellteilungsrate im erwachsenen Hirn und Rückenmark regeln. Von den Proteinen, die Vermehrung, Fortbestehen und Differenzierung der von Erwachsenen gewonnenen Stammzellen regulieren, konnten die Forscher unlängst die ersten identifizieren. Und bezüglich der Umwelteinflüsse lernten sie aus Tierexperimenten, dass unter Stress die Rate der neugebildeten Nervenzellen sinkt, die Überlebensdauer der Nervenzellen hingegen ansteigt, wenn die Tiere in einer abwechslungsreichen Umgebung leben, und körperliche Bewegung zu einer Steigerung der Neurogenese führt.
Mit seinen Forschungsarbeiten verfolgt Prof. Gage das Ziel, Strategien zu entwickeln, mit deren Hilfe Funktionsstörungen behoben werden können, die auf Zerstörungen im zentralen Nervensystem beruhen. Das aber kann nur gelingen, wenn man zuvor die grundlegenden neurobiologischen Prozesse der neuronalen Plastizität verstehen gelernt hat.
Preisträger 2002
Prof. Michael Merzenich wird ausgezeichnet für seine Arbeiten zur Reorganisationsfähigkeit des Hirns.
Prof. Michael Merzenich, 1942 in Lebanon, Oregon/USA geboren, studierte Medizin an der University of Portland, Portland/Oregon, und an der Johns Hopkins University in Baltimore/Maryland, wo er 1968 promoviert wurde. Es folgte ein dreijähriges Postdoktorat am Laboratorium für Neurophysiologie der University of Wisconsin in Madison. 1971 wurde Merzenich Professor und Forschungsdirektor am Department für Ohren-Halsleiden (Otolaryngology) und Physiologie der University of California in San Francisco (UCSF). Gleichzeitig ernannte man ihn zum Direktor des dortigen Coleman Memorial Laboratory. Seit 1980 ist er Vice-Chairman des Departments. Die von ihm geleiteten Forschungsteams entwickelten ein künstliches Innenohr (Cochlea-Implantat), mit dessen Hilfe es ertaubten Menschen möglich wird, wieder Sprache zu hören und zu verstehen. 1996 war Professor Merzenich Mitbegründer und erster Präsident der "Scientific Learning Corporation" in Oakland/California, die wirksame und allgemein nutzbare Therapien entwickelt für Kinder mit gestörtem Sprachverständnis, Lese- und Wahrnehmungsstörungen. Mit den dort konzipierten Trainings- und Lernprogrammen konnten bis heute mehr als 170.000 solcher Fälle erfolgreich behandelt werden. Sechs Jahre später begründet er die "Neuroscience Solutions Corporation" in San Francisco mit, als deren Chief Scientific Officer er fungiert. Sie widmet sich der Therapieentwicklung für alte und psychisch kranke Menschen sowie für Patienten mit erworbenen Bewegungsstörungen und chronischen Schmerzsyndromen. Merzenich ist Mitinhaber von 43 US-amerikanischen und mehr als hundert ausländischen Patenten. Er wurde mit vielen nationalen und internationalen Preisen geehrt (darunter 1997 dem Ipsen Prize, Paris, und 2000 dem Thomas Alvar Edison Prize) und erhielt eine Fülle von Auszeichnungen (1993 und 1997 übertrug man ihm unter anderem die Martin Schwab Lecture der American Association for Clinical Neurophysiology in San Francisco), außerdem ist er Mitglied mehrerer Akademien, darunter der National Academy of Sciences in den USA.
Merzenich erlangte erstes internationales Ansehen durch seine Erfahrungen mit ertaubten Menschen, die das von ihm mitentwickelte künstliche Innenohr eingesetzt bekamen. Patienten mit einem solchen "Cochlea-Implantat" hören anfangs nur ein Durcheinander von Geräuschen. Der Grund: Das künstliche Organ nimmt über ein außerhalb des Körpers angebrachtes Mikrophon Töne und Geräusche aus der Umgebung auf und wandelt sie in elektrische Signale um. Über Drähte werden diese dem Hörnerv zugeführt, der sie zum Gehirn weiterleitet. Die vom Implantat ausgehende Impulsfolge stimmt allerdings weder in der zeitlichen noch in der räumlichen Ordnung mit jener Folge überein, die ein viel empfindlicheres natürliches Innenohr generiert. Das Gehirn vermag die künstlich erzeugten und via Hörnerv bei ihm eintreffenden Impulse nicht einzuordnen und deutet sie deshalb als dumpfes Geräusch.
Merzenich arbeitete mit diesen Patienten und machte dabei eine verblüffende Beobachtung: Das Gehirn verfügt offenbar über genügend Plastizität, um sich bei entsprechendem Training so umzuorganisieren, dass es die neuen Signale entziffern kann - eine damals völlig neue Erkenntnis. Das Training bestand darin, dass Merzenich die Chochlea-Implantat-Träger bat, eine Liste von Wörtern gemeinsam mit ihm laut vorzulesen. Nach einigen Wiederholungen nahmen die Patienten kein dumpfes Geräusch mehr wahr, sondern hörten die einzelnen Wörter. Das Verfahren wurde dann auf gemeinsam gesprochene Sätze und ganze Texte ausgedehnt. Der erhoffte Erfolg stellte sich nach einigen Monaten ein: Die so trainierten Patienten gewannen ihr Hörvermögen zurück und konnten zumindest normale Sprache wieder verstehen.
Die mit dieser Plastizität des Hirns einhergehenden neurobiologischen Veränderungen untersuchten Merzenich und Mitarbeiter an Tiermodellen. Beispielsweise trainierten sie Affen so, dass diese zwei nahe beieinanderliegende Töne zu unterscheiden lernten. Die Folge: Die Größe des für die Wahrnehmung dieses Frequenzbereichs zuständigen Hirnrindenareals nahm zu. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen die Forscher, wenn sie den Tastsinn untersuchten: Bei Affen, denen man beigebracht hatte, mit den Spitzen von Zeige-, Mittel- und Ringfinger verschiedene Vibrationsfrequenzen zu unterscheiden, vergrößerte sich der diese Finger repräsentierende Hirnrindenbereich deutlich.
Das war ein völlig unerwarteter Befund. Ende der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten Wissenschaftler bei Gehirnsondierungen an Patienten entdeckt, dass der Teil der Großhirnrinde, der für die Verarbeitung von Tastempfindungen zuständig ist, eine landkartenähnliche Repräsentation der Körperoberfläche enthält. Allerdings ist sie nicht proportional zu dieser Oberfläche. Lippen und Hände liefern dem Menschen weitaus wichtigere Tastempfindungen als etwa der Rücken. Entsprechend ist dem Rücken nur wenig Hirnrinde zugeordnet, während für Lippen und Hände viel größere Areale zur Verfügung stehen. Anhand der so identifizierten Bereiche wurde später das sensorische "Rindenmännchen" konstruiert: Ein Wesen mit winzigem Körper, aber riesengroßen Lippen und Händen, das man über die entsprechenden Abschnitte der Hirnrinde zeichnete. Die Forscher nahmen damals an, dass die Form dieses (und des motorischen) Rindenmännchens, das heißt die Funktion der einzelnen Hirnrindenareale, von Geburt an unveränderlich festgelegt ist - eine Vorstellung, die Merzenich widerlegen konnte.
Seine Untersuchungen führten zu immer klareren Vorstellungen, wie Plastizitätsvorgänge in der Hirnrinde beitragen zu einer verfeinerten Repräsentation komplexer sensorischer und auch motorischer Signale während der kindlichen Entwicklung. Und sie zeigten, dass das Gehirn lebenslang die Fähigkeit zu plastischen Veränderungen behält - viele während der Kindheit eingetretene Fehlentwicklungen lassen sich deshalb später durch intensives Training korrigieren. Darüber und über die auf diesen neurophysiologischen Erkenntnissen basierenden Therapieerfolge berichtet Merzenich in seinem Festvortrag anläßlich der Verleihung des Zülch-Preises in Köln.
Prof. Martin Schwab erhält die Auszeichnung für seine Untersuchungen über die Regenerationsmöglichkeit geschädigter Nervensysteme.
Prof. Martin Schwab, 1949 in Basel geboren, studierte an der Universität seiner Geburtsstadt Zoologie (sowie Botanik und Chemie) und wurde dort 1973 mit einer neuroanatomischen Arbeit promoviert. Von 1974 bis 1978 arbeitete er als Postdoc am Biozentrum der Universität Basel. Nach seiner Habilitation war er Research Fellow am Department of Neurobiology der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts/USA, und von 1979 bis 1985 Gruppenleiter am Department für Neurochemie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in Martinsried bei München. 1985 wurde er als Professor für Hirnforschung an die Universität Zürich berufen und dort zum Co-Direktor des Hirnforschungsinstituts ernannt. Und seit 1997 gehört er gleichzeitig als Professor für Neurowissenschaften dem Department für Biologie der ETH Zürich an. Schwab ist Träger vieler Auszeichnungen und Ehrungen, darunter dem Ernst Jung Preis für Medizin (1992) und der Carus-Medaille der Deutschen Akademie für Naturforschung Leopoldina (2000), ist Mitglied der Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften sowie Fachbeiratsmitglied zahlreicher in- und ausländischer Stiftungen und Institute (unter anderem der Max-Planck-Institute für Entwicklungsbiologie in Tübingen und für Hirnforschung in Frankfurt).
"Und sie wachsen doch - die Nervenfasern im verletzten Rückenmark" lautete der Titel des Festvortrags, den Prof. Schwab anläßlich der Preisverleihung in Köln hielt. Damit ist zugleich sein Forschungsgebiet umschrieben: die Untersuchung von Nervenwachstumsfaktoren. Verletzungen des Rückenmarks unterbrechen die Nervenbahnen, die die Nervenzentren des Rückenmarks mit dem Gehirn verbinden, Durch diese Unterbrechung können weder Bewegungsimpulse aus dem Hirn an das Rückenmark vermittelt werden (was zur Querschnittslähmung führt) noch erreichen in Gegenrichtung die über sensorische Nerven an das Rückenmark weitergegebenen Empfindungen aus dem Körperbereich das Gehirn. Da die Nervenfasern des Rückenmarks und des Gehirns keine Fähigkeit zum Nachwachsen haben, bleibt eine Querschnittslähmung lebenslang bestehen.
Das ist eigentlich erstaunlich, denn in den peripheren Nerven außerhalb von Rückenmark und Gehirn findet ein Nachwachsen verletzter Nervenfasern durchaus statt - zum Beispiel nach dem Wiederannähen von abgetrennten Fingern oder nach Nervenquetschungen. Schwab und Mitarbeiter postulierten deshalb die Existenz von spezifischen Wachstumshemmstoffen in Rückenmark sowie im Gehirn. In biochemischen und zellbiologischen Experimenten gelang ihnen tatsächlich der Nachweis, dass vor allem in der Myelinhülle der Nervenfasern von Säugetieren (einschließlich Menschen) sehr wirksame Wachstumshemmstoffe vorhanden sind. Einen dieser äußerst aktiven Hemmstoffe, ein großes, neuartiges Membraneiweiß, konnte von den Wissenschaftlern gereinigt und molekularbiologisch charakterisiert werden. Das Eiweiß, Nogo-A genannt, weist zwei spezifische Stellen auf, mit denen es mit Rezeptoren auf wachsenden Nervenfasern in Wechselwirkung tritt und so deren Wachstum stoppt. Die Bedeutung des Hemmstoffs bewies ein Test: Pflanzte man Mäusen ein Nogo-A-Gen in periphere Nerven ein, so konnten sie Verletzungen dieser Nerven nur noch schlecht reparieren.
In weiteren Versuchen spritzten die Forscher rückenmarks- oder gehirnverletzten Ratten zwei Wochen lang Antikörper gegen Nogo-A und andere Wachstumshemmstoffe in die Gehirnflüssigkeit. Als Folge wurde ein verstärktes Aussprossen von Nervenfasern beobachtet, das zum Teil in ein Nervenwachstum über große Teile des Rückenmarks überging. Die Lauf- und Bewegungsfähigkeiten der so behandelten Tiere verbesserten sich stark. Die Antikörpergaben setzten aber nicht nur die Regeneration verletzter Nervenfasern in Gang, sondern stimulierten auch eine Neubildung von Nervenschaltkreisen. "Unsere Experimente zeigen", so Schwab in seinem Festvortrag, "dass die alte Vorstellung vom erwachsenen Gehirn und Rückenmark als starres, kaum zur Reparatur fähiges Organsystem revisionsbedürftig ist". Denn durch temporäre Unterdrückung endogener Wachstumshemmstoffe können regenerative und plastische Prozesse im erwachsenen Zentralnervensystem ausgelöst werden, die letztlich zu einer Erholung vitaler Verhaltensweisen und Funktionen führen. "Die starken Ähnlichkeiten dieses grundlegenden biologischen Mechanismus bei Versuchstieren und Menschen", so Schwab abschließendete, "lässt die Hoffnung aufkeimen, dass neue therapeutische Strategien für rückenmarks- und gehirnverletzte Patienten entwickelt werden können."
Preisträger 2001
Prof. Gillian Patricia Bates, 1956 in Kenilworth bei Birmingham geboren, studierte in Sheffield und London. Sie promovierte 1987 an der London University und forschte von 1987 bis 1993 als Postdoctoral Fellow im Genome Analysis Laboratory des Imperial Cancer Research Fund (ICRF) in London. Hier begann eine intensive Zusammenarbeit mit Prof. Hans Lehrach, der damals ebenfalls an diesem Labor tätig war. Beide publizierten zwischen 1989 und 1994 gemeinsam und als Mitverfasser zahlreiche Artikel über ihre Forschungen bezüglich des die Huntingtonsche Krankheit auslösenden Gens. Dann trennten sich ihre Wege: Hans Lehrach ging 1994 als Direktor an das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin und Gillian Patricia Bates wurde Senior Lecturer in Molecular Biology an den United Medical and Dental Schools sowie 1998 Professorin für Neurogenetics an der GKT School of Medicine, King's College in London. Ihre Arbeitsgruppen kooperierten aber weiterhin eng miteinander. Zur Förderung dieser Zusammenarbeit erhielt Frau Bates im Jahr 1999 den Max-Planck-Forschungspreis - eine der vielen Auszeichnungen, die ihr bislang verliehen worden sind.
Chorea Huntington ist der Forschungsschwerpunkt von Prof. Bates. Bei diesem Leiden handelt es sich um eine Erbkrankheit des Menschen, bei der selektiv Nervenzellen in bestimmten Bereichen des Gehirns absterben. Die Krankheitssymptome sind unkontrollierte Bewegungen, Geistesgestörtheit, Gemütsstörungen und Muskellähmungen. Bei den meisten Patienten treten die ersten Symptome ab dem 40. Lebensjahr auf. Das Leiden führt 15 bis 20 Jahre nach dem Ausbruch zum Tod.
1993 gelang einer internationalen Forschergruppe unter maßgeblicher Beteiligung von Gillian Patricia Bates die molekulare Identifizierung des Gens, das mit der Entstehung von Chorea Huntington verknüpft ist. Das Produkt dieses Gens ist ein hochmolekulares Protein - Huntingtin genannt -, über dessen natürliche Funktion die Forscher noch rätseln. Durch vergleichende Analysen des Gens bei Gesunden und bei Huntington-Patienten fand man heraus, dass es sich bei der Mutation, die der Krankheit zugrunde liegt, um ein so genanntes verlängertes CAG-Repeat handelt. Ein Repeat ist ein Genabschnitt, in dem eine bestimmte Sequenz von drei Basen mehrmals aufeinander folgt. Im Fall von Chorea Huntington handelt es sich um das Triplett Cytosin-Adenin-Guanin (CAG), das den Code für die Aminosäure Glutamin bildet. Im normalen Gen wiederholt sich dieses Triplett zwischen 6- und 36-mal, während es bei Huntington-Patienten bis zu 180-mal aufeinanderfolgt.
Die Arbeitsgruppe von Prof. Lehrach am Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik hat gezeigt, dass im Reagenzglas Huntingtine mit mehr als 51 Glutaminen zu unlöslichen Aggregaten verklumpen, die eine fibrilläre, faserartige Feinstruktur aufweisen. Solche Aggregate fanden sich auch im Gehirn von Mäusen, denen man ein menschliches Huntington-Gen mit überlangen CAG-Repeats übertragen hatte: Prof. Bates gelang in Zusammenarbeit mit den Berliner Forschern und einer Gruppe am University College in London der Nachweis, dass in den Nervenzellkernen der transgenen Mäuse Einschlüsse des verklumpten menschlichen Huntingtin-Proteins vorliegen.
Nachkommen der transgenen Mäuse zeigten diese Einschlüsse bereits im Alter von vier Wochen, während die für Chorea Huntington charakteristischen motorischen Störungen erst von der fünften Woche an auftraten (und ein Absterben neuronaler Zellen frühestens nach 14 Wochen nachzuweisen war). Daraus leiteten Prof. Bates und ihre Kollegen die Vermutung ab, nicht das Absterben von Nervenzellen löse die Krankheitssymptome aus, sondern eine von den Aggregat-Einschlüssen verursachte neuronale Fehlfunktion sei dafür verantwortlich. Viele Anzeichen deuten inzwischen darauf hin, dass es sich dabei um Störungen bei der Transkription bestimmter Gene handelt.
Mit dem - das Huntington-Gen tragende - transgenen Mäusestamm stand den Wissenschaftlern erstmals ein Modellorganismus zur Verfügung, an dem sich die Symptomatik und die molekularen Prozesse der Chorea Huntington-Erkrankung im Detail studieren ließen und der eine Möglichkeit bot, therapeutische Ansätze zu erproben. Innerhalb von nur vier Jahren, so Prof. Bates, seien viele der in dieses Modell gesteckten Hoffnungen realisiert worden: "Die neuropathologischen Kennzeichen von Polyglutamin-Krankheiten wurden aufgedeckt, wichtige Einsichten in die frühen Stadien des Krankheitsprozesses gewonnen und Verbindungen gefunden, die - nachdem sie sich bei den transgenen Mäusen als wirksam erwiesen - jetzt schon die ersten Phasen einer klinischen Prüfung durchlaufen."
Prof. Jean Louis Mandel, 1946 in Straßburg geboren, studierte an der dortigen Universität Medizin (Promotion 1971) und Biochemie (Promotion 1974). Er wurde 1975, nach einem zweijährigen Postdoctoral-Training am Department für Medical Genetics an der University of Toronto, Lecturer in Biochemistry an der medizinischen Fakultät der Straßburger Universität. Zeitgleich wurde er Mitarbeiter im Forschungslabor von Prof. Pierre Chambon, wo er an der Entdeckung der Mosaikstruktur von Genen beteiligt war. 1978 ernannte ihn die Fakultät zum Assistant- und später zum Full Professor für Genetik. Seit 1985 leitet er außerdem das "DNA Diagnostic Laboratory for Genetic Diseases". Auch Prof. Mandel, der dem Fachbeirat des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin angehört, ist Träger vieler hoher wissenschaftlicher Auszeichnungen, unter anderem erhielt er 1999 den Medizin-Preis der Louis-Jeantet-Foundation.
Seit 1991 wurden in Mandels Laboratorium die Gene und Genmutationen wichtiger mono-genetischer Krankheiten identifiziert. Besondere Aufmerksamkeit fanden dabei die Arbeiten, die sich mit der Identifikation und Untersuchung eines zu jener Zeit neuen und unerwarteten Mutationsmechanismus beschäftigten: der unstetigen Expansion von Trinukleotid-Repeats, also genau jener ausufernden und in ihrer Wirkung fatalen Wiederholungen, die auch Chorea Huntington auslösen.
Dieser Mechanismus ist, wie Mandel und seine Mitarbeiter nachwiesen, die Ursache von mehr als 15 neurologischen Krankheiten und erklärt die speziellen familiären Ausbreitungsmuster solcher Leiden. Beispielsweise wurde demonstriert, dass eine Expansion von Cytosin-Guanin-Guanin-Repeats in Verbindung mit einer abnormalen Methylierung das so genannte Syndrom des fragilen X-Chromosoms auslöst. Diese überwiegend bei Männern vorkommende Erbkrankheit äußert sich in einer verzögerten motorischen und geistigen Entwicklung mit Sprachentwicklungsstörungen, Aggressivität und Autismus. Sie entsteht durch Fehler bei der Transkription eines Gens an der brüchigen Stelle des X-Chromosoms. 1991 gelang Mandels Arbeitsgruppe auch die Charakterisierung von zwei Gen-Ausprägungen (Premutation und Vollmutation) und deren unterschiedlichen Vererbungsmustern - eine Entdeckung, die sowohl die Pränataldiagnose als auch die anschließende genetische Beratung revolutionierten.
Die Expansion einer anderen Triplett-Wiederholung, des Guanin-Adenin-Adenin-Repeats, verursacht, wie Mandel und seine Mitarbeiter zeigten, die so genannte Friedreich-Ataxie, eine fortschreitende Koordinationsstörung von Bewegungsabläufen. Sie beginnt meist im frühen Jugendalter mit Problemen beim Gehen und Stehen sowie Störungen des Lagesinns. Ähnliche Symptome zeigen auch einzelne Typen der Spinozerebellären Ataxien, deren Gene ebenfalls von Mandels Arbeitsgruppe identifiziert wurden.
Gegenwärtig konzentrieren sich die Arbeiten in Mandels Forschungslabor - neben der Beschäftigung mit Chorea Huntington und der Krankheit des fragilen-X-Syndroms - auf eine Klärung der pathologischen Mechanismen bei der Myotubularen Myopathie, einer erblichen Muskelerkrankung, und der Adrenoleukodystrophie, einer familiär gehäuft auftretenden Lipidspeicherkrankheit mit Störungen im Fettstoffwechsel. Für diese Krankheiten versuchen die Wissenschaftler außerdem zelluläre Modelle oder Tiermodelle zu entwickeln, um daran therapeutische Strategien zu erproben.
Preisträger 2000
Prof. Alim Louis Benabid wird ausgezeichnet für seine technischen und funktionellen Weiterentwicklungen von Verfahren zur Behandlung des Morbus Parkinson.
Prof. Alim Louis Benabid, 1942 in La Tronche bei Grenoble geboren, studierte an der Universität Grenoble Medizin (Promotion 1970) und Physik (Promotion 1978). 1978 erhielt er an dieser Universität eine Professur für Experimentelle Medizin, 1984 wurde er Professor für Biophysik und seit 1989 leitet er die Neurochirurgie am Hospital Grenoble. Außerdem ist er Direktor des Laboratoriums für Neurobiophysik und Leiter der INSERM Forschungsgruppe "Präklinische Neurobiologie".
Ein Schwerpunkt der Forschungen von Prof. Benabid (über die er in Köln berichtete) sind Bewegungsstörungen bei Parkinson-Patienten. Zu den Hauptsymptomen dieser - auch als "Schüttellähmung" bezeichneten - Krankheit gehören Tremor (Zittern), Rigor (Starre) und Akinese (Mangel an Willkür- und Reaktivbewegungen). Das Zittern ist häufig das erste Anzeichen der Erkrankung, doch am stärksten werden die Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium durch die Akinese beeinträchtigt: Sie können Arme oder Beine kaum noch bewegen und haben größte Schwierigkeiten beim Gehen. Seit Anfang der siebziger Jahre gibt es zwar eine Therapie - die Verabreichung der Aminosäure L-Dopa, die im Gehirn in die fehlende Transmittersubstanz Dopamin umgewandelt wird -, doch lässt die Wirkung dieses Medikaments im Laufe der Zeit nach. Außerdem bleibt bei manchen der mit L-Dopa behandelten Patienten der Tremor bestehen.
Diesen Kranken versuchen die Neurochirurgen durch eine Operation zu helfen: Durch ein kleines Loch in Schädel wird unter örtlicher Betäubung eine nadelförmige Sonde in den tief liegenden Thalamus versenkt und dort durch elektrisch erzeugte Wärme ein Teil des Gewebes zerstört (koaguliert) - was sofort zu einem Stopp des Zitterns führt. Für solche gezielten Operationen entwickelte Prof. Benabid in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Informatikern und Technikern einen stereotaktischen Roboter (Neuromat), mit dessen Hilfe die zu operierenden Hirnareale auf Bruchteile eines Millimeters genau angesteuert werden können.
Während eines solchen Eingriffs werden die umliegenden Hirnbereiche elektrisch stimuliert, um ihre Funktion zu bestimmen und - falls sie lebenswichtig sind - ihre Zerstörung bei der Operation zu vermeiden. Bei solchen Tests entdeckte Benabid, dass bei der hochfrequenten Stimulierung eines bestimmten Thalamusbereichs (des ventralen intermedialen thalamischen Kerns, VIM) der Tremor des Patienten unterdrückt wird. Diese Beobachtung nutzte der Wissenschaftler zur Entwicklung einer Behandlungsmethode - der Deep Brain Stimulation (DBS) - , die inzwischen an mehr als hundert Patienten erfolgreich erprobt wurde und die operative Zerstörung von Thalamusbereichen ersetzen kann.
An einer DBS-Therapie für die anderen Bewegungsstörungen der Parkinson-Patienten (Rigor und Akinese) wird in Benabids Forschungsgruppe ebenfalls gearbeitet. Sie basiert auf der chronischen Stimulierung einer anderen Hirnregion - des subthalamischen Kerns (STN) - und könnte zu einer Methode der Zukunft werden. Denn erste Langzeitversuche mit diesem neuen Behandlungsverfahren deuten darauf hin, dass die Wirkung weit über eine bloße Linderung der Symptome hinausgeht. Tierversuche und klinische Studien sollen nun zeigen, ob es sich bei den positiven Ergebnissen nur um individuelle statistische Fluktuationen handelt oder ob hier, wie Benabid und Mitarbeiter vermuten, ein neuroprotektiver Effekt vorliegt, der ein Fortschreiten der Krankheit bei den behandelten Patienten deutlich verlangsamt.
Dass mit der STN-Stimulierung auch bestimmte Epilepsieformen zu unterdrücken sind, haben Versuche an Ratten gezeigt. Inzwischen wird das Verfahren auch an Menschen erprobt. So implantierten Benabid und Mitarbeiter im November 1998 einem sechsjährigen Mädchen einen entsprechenden Stimulator. Seit Dezember 1998 ist das Kind, das vorher bis zu 20 Anfälle am Tag und eine ähnlich große Anzahl in der Nacht hatte, tagsüber anfallsfrei. Die nächtlichen Anfälle haben sich auf zwei bis drei reduziert. Das Mädchen kann inzwischen wieder Spaziergänge unternehmen, spielen und die Schule besuchen; die tägliche Medikamentendosis wurde signifikant reduziert. Die Forscher hoffen, die Methode zu einer nichtoperativen Therapie für einige pharmakoresistente Epilepsieformen entwickeln zu können.
Prof. George Alvin Ojemann erhält die Auszeichnung für seine Untersuchungen zur funktionalen Organisation der Großhirnrinde des Menschen.
Prof. George Alvin Ojemann, 1935 in Iowa City geboren, studierte Medizin an der State University of Iowa, wurde 1959 promoviert und erhielt 1960 die Approbation als Arzt. Seine Postdoc-Ausbildung absolvierte er am King County Hospital in Seattle und - in Neurochirurgie - an der University of Washington, ebenfalls in Seattle. 1968 wurde er Assistant Professor und 1971 Associate Professor für Neurochirurgie an der School of Medicine dieser Universität, die ihn 1979 zum Full Professor berief. Von 1986 bis 1996 war er Direktor des dortigen Epilepsie Centers. In dieser Zeit begann eine enge Zusammenarbeit mit dem inzwischen verstorbenen Hirnforscher Prof. Otto Creutzfeldt, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, auf dem Gebiet der Gehirnsondierung mit extrazellulären Mikroelektroden. Daraus entstanden mehrere gemeinsame Veröffentlichungen. Neben einer großen Zahl von Fachpublikationen veröffentlichte Ojemann - gemeinsam mit dem Neurobiologen William Calvin - auch zwei populärwissenschaftliche Bücher: "Inside the Brain" (1980) und "Conversation mit Neil's Brain" (1994, eine deutsche Übersetzung erschien 1995 unter dem Titel "Einsicht ins Gehirn - Wie Denken und Sprache entstehen" im Hanser Verlag).
Im Rahmen seiner Arbeiten zur Verbesserung chirurgischer und neurophysiologischer Behandlungsmethoden der Epilepsie konnte Ojemann grundlegende neue Erkenntnisse über die Organisationsmechanismen von Sprache und Gedächtnis im menschlichen Hirn gewinnen (über die er in Köln vortrug). Wenn Chirurgen bei Epilepsie-Patienten bestimmte Hirnareale zerstören (koagulieren oder auflösen), um so die Zentren der epileptischen Entladungen auszuschalten, müssen sie darauf achten, nicht auch sprach- und gedächtnisrelevante Bereiche zu verstümmeln. Deshalb sondieren sie im Hirn der für eine Operation vorgesehenen (und mit der Untersuchung einverstandenen) Patienten, ob in der Nähe der Entladungsherde Sprach- und Gedächtnisareale liegen.
Bei allen Arten von Sprachstörungen treten zugleich Schwierigkeiten bei der Benennung von Objekten auf. Solche Benennungsprobleme lassen sich nutzen, wenn man im Gehirn nach Arealen sucht, die für die Sprache von Bedeutung sind. Dabei stimuliert man im Hirn des wachen Patienten, dessen Schädeldecke zuvor durchbohrt oder teilweise entfernt wurde, mit einer elektrischen Sonde einzelne Bereiche, während er bestimmte Aufgaben bewältigen muss - z.B. die Objekte benennen, die ihm auf Dias gezeigt werden. Hat der Patient dabei Schwierigkeiten und kann etwa beim Bild eines Elefanten nicht das Wort Elefant aussprechen, so weiß der Neurochirurg, dass er einen für die Sprache essenziellen Bereich gereizt und damit das Sprachvermögen gestört hat.
Ähnlich verläuft die Suche nach gedächtnisrelevanten Hirnarealen: Dem Patienten wird eine Folge von mehreren Dias vorgeführt, von denen das erste z.B. ein Objekt zeigt, das benannt und dessen Name gemerkt werden soll (Speicherung). Das zweite Dia enthält einen Satz, den der Patient vorlesen muss (Ablenkung), und auf Dia 3 wird er aufgefordert, den Namen des Objekts von Dia 1 noch einmal zu nennen (Erinnerung).
Während der Diashow wurden gleichzeitig bestimmte Hirnareale stimuliert. Anhand der dabei erzeugten Beeinträchtigungen liess sich erkennen, wo im Hirn die kurzzeitige Speicherung erfolgt und welche Bereiche beim Erinnern mitwirken. Eine weitere Sondierungsmethode ist die Mikroelektrodenmessung, mit der sich nachweisen lässt "welche Neuronen sich wofür interessieren" (Ojemann). Mikroelektroden sind haarfeine Drähte, mit denen man dicht an einzelne Neuronen herankommen und deren Aktivität ermitteln kann. Auf diese Weise kann der Chirurg beispielsweise testen, ob auch Neuronen außerhalb des per Stimulierung lokalisierten relevanten Sprachbereichs eine Aktivitätsteigerung bei der Bennenung von Objekten zeigen.
Aus derartigen Kartierungen des Hirns können die Forscher ablesen, welche Gebiete "essenziell" für die Sprache oder für das verbale Arbeitsgedächtnis sind. Diese exakt zu lokalisierenden Orte variieren, wie Ojemann beobachtete, von Patient zu Patient ganz beträchtlich. Außerdem wies er nach, dass die für verschiedene Sprachen (z.B. Englisch und Spanisch) relevanten Gebiete im Gehirn räumlich voneinander getrennt sind. Die Mikroelektrodenmessungen ergaben ferner, dass Neuronen bei Gedächtnis-Experimenten (etwa beim Erinnern an eine Benennung) nicht nur in den "essenziellen" Hirnbereichen, sondern auch in einigen "nichtessenziellen" Hirnarealen eine veränderte Aktivität aufweisen.
Diese Neurone scheinen zu einem neuronalen Netzwerk zu gehören, das an Assoziationen beteiligt ist. Beispielsweise zeigt ein Teil jener Neurone, die bei der Identifizierung eines Objekts oder einer Aussage mitwirken, auch dann eine stetig steigende Aktivität, wenn neue Assoziationen zwischen verbalen Aussagen erlernt werden. Erst wenn sich die Assoziation eingeprägt hat, geht die Aktivität dieser Neuronen wieder zurück. Solche Forschungsergebnisse, dessen ist sich Ojemann sicher, sind erste Schritte auf dem Weg zu einem besseren Verständnis, welche neuralen Substrate an menschlichen Denkprozessen mitwirken.
Preisträger 1999
Prof. Thomas Jentsch wird ausgezeichnet für seine Beiträge zum Verständnis von Ionenkanal-Krankheiten in der Neurologie.
Prof. Thomas Jentsch, 1953 in Berlin geboren, studierte von 1972 - 1978 Medizin (Approbation als Arzt 1979) und von 1974 - 1980 Physik an der Freien Universität Berlin. 1980/81 arbeitete er als Physik-Diplomand (Diplom-Prüfung 1980) und Doktorand (Promotion zum Dr.rer.nat 1982 ) bei Prof. Block am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Anschließend war er fünf Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Klinische Physiologie der FU Berlin (Prof. Wiederholt) tätig. 1984 wurde er zum Dr.med. promoviert. Von 1986 - 1988 arbeitete Jentsch als "postdoctoral fellow" am Whitehead Institute des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge/USA, und von 1988 bis 1993 war er Leiter einer selbständigen Arbeitsgruppe am Zentrum für Molekulare Neurobiologie der Universität Hamburg, an der er sich auch im Fach Zellbiologie habilitierte (1991). 1993 erhielt er einen Ruf als Professor für Molekulare Neuropathologie an das Zentrum für Molekulare Neurobiologie der Universität Hamburg, dem er zwischen 1995 und 1998 als Direktor vorstand. Jentsch ist Träger zahlreicher wissenschaftlicher Auszeichnungen, darunter des Wilhelm-Vaillant-Preises für klinische und theoretische Medizin (1992), des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1995), des Alfred-Hauptmann-Preises für Epilepsieforschung (1998) und des Franz-Volhard-Preises für Nephrologie (1998).
Die Annahme des Zülch-Preises ist mit der Verpflichtung verbunden, im Rahmen der Preisverleihung einen Vortrag über die mit dem Preis ausgezeichneten Forschungsarbeiten zu halten. Prof. Thomas Jentsch referierte am 29. September 1999 über das Thema "Krank durch defekte Ionenkanäle". Alle Zellen und alle Reaktionsräume (Kompartimente) im Inneren von Zellen werden von Lipidmembranen umschlossen. Dadurch können dort die Konzentrationen von Ionen und organischen Molekülen reguliert und optimale Reaktionsbedingungen eingehalten werden. Um dies zu bewerkstelligen - und um Signale über die Membranen fortzuleiten - ist ein geregelter Transport über diese trennenden Lipidgrenzen notwendig.
Der Transport wird ermöglicht durch eine Vielzahl stark spezialisierter Proteine, die in die äußere (Plasma-)Membran wie auch in die inneren Membranen eingebaut sind. Diese Proteine bilden selektive und zum Teil hochregulierte Poren (Ionenkanäle) in der Membran, durch die Ionen diffundieren können.
Auf diese Weise kann die Ionenkonzentration innerhalb der Zelle völlig andere Werte annehmen als außerhalb, was nicht nur der Bereitstellung eines geeigneten intrazellulären Milieus dient, sondern auch dem Transport über Körperflächen (Epithelien) hinweg - etwa bei der Flüssigkeits- und Salzresorption im Darm oder in der Niere. Darüber hinaus hat der Konzentrationsunterschied - vor allem im Nervensystem - große Bedeutung für die Signalverarbeitung: Der elektrische Strom, der mit einer Nettobewegung von Ionen über die Plasmamembran einhergeht, ist die Grundlage für die Datenverarbeitung in unserem Gehirn.
Nach der Selektivität der Kanäle für bestimmte Ionen unterscheidet man zum Beispiel Kalium-, Natrium- und Chlorid-Kanäle. So vielfältig wie ihre unterschiedlichen Rollen - von der Signalleitung und dem Transport über Epithelien bis zur Regulation des Zellvolumens und, indirekt, zum Transport von intrazellulären Vesikeln - sind auch die Symptome und Krankheiten, die bei einer Fehlfunktion oder einem Ausfall von Kanalproteinen beobachtet werden können.
Der Klon aus dem Zitterrochen
Vor knapp einem Jahrzehnt gelang es Jentsch und Mitarbeitern zum ersten Mal, das Gen für einen spannungsabhängigen Chloridkanal - für ein Protein, das negativ geladene Chlorionen in Abhängigkeit von der elektrischen Spannung durch die Membran diffundieren läßt - zu klonieren. Als Modellsystem wurde dabei zunächst das elektrische Organ des Zitterrochens gewählt, das - um die zur Betäubung von Fischen erforderlichen hohen Spannungen und Stromstärken zu erzielen - eine besonders hohe Konzentration an solchen Kanälen besitzt. Ausgehend von diesem Fischgen sei es dann, so Jentsch, relativ einfach gewesen, verwandte Kanalgene aus Säugetieren (einschließlich des Menschen) zu isolieren. Inzwischen wissen die Forscher, daß im Menschen mindestens neun verschiedene Gene für verwandte Chloridkanäle existieren, die ihrerseits unterschiedliche Funktionen in diversen Geweben und Zellen erfüllen - und bei einem genetischen Ausfall zu verschiedenen Krankheiten führen.
Das elektrische Organ des Fisches ist im Laufe der Entwicklung aus der Muskulatur entstanden. Der engste "Säugetierverwandte" des klonierten Fischkanals war deshalb der - ClC-1 genannte - Chloridkanal der Muskulatur. Er sitzt in der Plasmamembran und stabilisiert das Membranpotential der Muskelzelle. Mutationen im ClC-1-Kanal führen zu einer elektrischen Übererregbarkeit und fehlender Erschlaffung des Muskels: Nach einem vom Gehirn als Befehl einlaufenden Nervenimpuls entsteht nicht nur eine kurze Zuckung, sondern eine länger anhaltende Kontraktion. Diese beeinträchtigte Muskelerschlaffung wird als "Myotonie" (Muskelsteifheit) bezeichnet. In Zusammenarbeit mit Humangenetikern konnte gezeigt werden, daß verschiedenen myotonen Erbkrankheiten des Menschen (Myotonia congenita) Mutationen im ClC-1-Kanal zugrundeliegen, die zu einem Ausfall dieses Kanals führen und damit die Regulation der elektrischen Muskelerregbarkeit aufheben.
Bei zwei anderen Chloridkanälen (ClC-Kb und ClC-5), die vorwiegend in der Niere vorkommen, konnten Jentsch und Mitarbeiter zeigen, daß sie recht unterschiedliche Funktionen besitzen und ihr Ausfall entsprechend verschiedene Nierener-krankungen zur Folge hat (massiver Salzverlust in der Niere bei ClC-Kb-Ausfall, Nierensteine und Nierenverkalkung bei ClC-5-Ausfall).
In den letzten beiden Jahren ist dem Team von Thomas Jentsch in Zusammenarbeit mit Ortrud Steinlein (Bonn) auch die Aufklärung von zwei Erbkrankheiten gelungen, die auf Mutationen von Kaliumkanälen beruhen: eine Neugeborenen-Epi-lepsie (durch Mutation der Kanäle KCNQ2 oder KCNQ3, was eine elektrische Übererregbarkeit von Nervenzellen im Gehirn zur Folge hat) und eine dominant vererbte, fortschreitende Taubheitsform (durch Mutation des Kanals KCNQ4 in den äußeren Haarzellen der Cochlea, des eigentlichen Hörorgans des Ohres).
Auf dem Gebiet der Ionenkanäle läßt sich dank neuer Methoden das ganze Spektrum vom Gen über Struktur und Funktion des Proteins und seine Bedeutung für die Zelle und den Organismus bis hin zu Krankheiten, die bei Fehlfunktionen entstehen, untersuchen. Dabei zeigt sich immer wieder, so Jentsch, wie Grundlagenforschung zügig in medizinische Erkenntnisse umgesetzt werden kann. Neben dem diagnostischen Wert, den die Aufklärung von Ionenkanal-Krankheiten zunächst hat, bilde das Verständnis der zugrundeliegenden pathophysiologischen Mechanismen auch das Fundament für rationale Therapieentwicklungen.
Prof. Hartmut Wekerle erhält die Auszeichnung für seine Arbeiten zur Aufklärung der grundlegenden Mechanismen bei Autoimmunkrankheiten des Nervensystems.
Prof. Hartmut Wekerle, 1944 in Waldshut geboren, studierte Medizin an der Universität Freiburg, wurde dort 1971 zum Dr. med. promoviert und arbeitete anschließend von 1970 - 1973 als "postdoctoral fellow" am Department of Cell Biology des Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel. Zwischen 1973 und 1982 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. In dieser Zeit habilitierte er sich im Fach Medizin an der Universität Freiburg (1977), die ihn 1980 zum Professor für Immunologie berief. Von 1982 bis 1989 leitete Wekerle die Klinische Forschungsgruppe "Multiple Sklerose" der Max-Planck-Gesellschaft in Würzburg, und seit 1988 ist er Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie (vormals Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Theoretisches Institut) in Martinsried. Wekerle erhielt viele wissenschaftliche Auszeichnungen, darunter den Jung-Preis für Wissenschaft und Forschung (1982), den Duchenne-Preis (1984), die Kroc Visiting Professorships in Chicago, London/Ontario, Los Angeles und San Diego (1990) sowie die Charcot Lecture in Venice (1998). Seit 1993 ist er Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Prof. Hartmut Wekerle sprach im Rahmen der Zülch-Preisverleihung zum Thema "Immunsystem und Nervensystem: eine delikate Beziehung - Das Beispiel Multiple Sklerose". Die Aufgabe des Nervensystems ist es, Reize aufzunehmen, sie zu verarbeiten und die Funktion einzelner Organe abzustimmen und sinnvoll zu steuern. Das Immunsystem hingegen wirkt als das Schutz- und Abwehrsystem des Körpers. Beide Organsysteme üben ihre Funktion nicht etwa beziehungslos nebeneinander aus, sondern stimmen sich sorgfältig gegenseitig ab: Zwischen Ner-ven- und Immunsystem bestehen vielfältige, komplizierte und delikate Wechselbeziehungen. Eine Störung des Zusammenspiels führt zu ernsthaften Erkrankungen.
Das Nervensystem steuert die Antwort des Immunsystems - entweder direkt über die Innervation (Versorgung) von Immunorganen, oder indirekt, etwa über hormonale Wege. Umgekehrt beeinflußt das Immunsystem die Funktion des Nervensystems, z.B. durch lösliche Immunmediatoren (steuernd in den Ablauf der immunologischen Abwehrreaktion eingreifende Stoffe wie Cytokine oder Chemokine), die über verschiedene Wege in das Nervensystem gelangen. Auch übt das Immunsystem seine Schutzfunktion im Nervensystem aus, allerdings auf recht ungewöhnliche Weise.
Ausnahmestatus des Nervensystems
Das Nervensystem genießt - aus immunologischer Sicht - einen Ausnahmestatus: Seine Immunüberwachung unterscheidet sich deutlich von der anderer Organe. Dafür sind strukturelle Besonderheiten des Nervensystems verantwortlich: Nervengewebe ist durch eine spezialisierte Endothelschicht vom Blutkreislauf abgeschottet - sie bildet eine für die meisten Blutzellen und Blutmoleküle undurchdringliche "Blut-Hirn-Schranke". Nur frisch aktivierte, nicht aber die Mehrzahl der ruhenden Lymphozyten - Abwehrzellen - können diese Schranke durchdringen. Außerdem fehlen im gesunden Hirn die in anderen Geweben reichlich vorhandenen Präsentierzellen (die sogenannten MHC-Proteine), die anderenorts fremde oder körpereigene Antigene gegenüber spezifischen T-Lymphozyten darbieten. Somit finden die aktivierten T-Lymphozyten, welche die Blut-Hirn-Schranke überwunden haben, zunächst keine für sie erkennbaren Antigene vor und sind deshalb außerstande, eine prompte Immunantwort einzuleiten.
Die Immunreaktivität im Nervensystem kann aber je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden: Bei ganz unterschiedlichen pathogenen Veränderungen ist beispielsweise die Neubildung von MHC-Präsentierzellen für Antigene und von Cytokinen zu beobachten. Sie finden sich oft in reichem Maße bei Entzün-dungsreaktionen, Virusinfektionen, Tumoren und - besonders faszinierend - neuronalen Degenerationsprozessen (zum Beispiel bei Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson oder Amyotropher Lateralsklerose). In derart veränderten Hirnarealen sind somit die Voraussetzungen für die Reaktivität der T-Lymphozyten erfüllt.
Es stellt sich die Frage nach den zellulären Mechanismen dieser ungewöhnlichen Kontrolle - besonders im Hinblick auf ihre mögliche Beteiligung an Erkrankungen des Nervensystems. Diese Frage behandelt Wekerle am Beispiel der Multiplen Sklerose (MS). MS wird weithin als "einfache" Autoimmunkrankheit angesehen. Die Wissenschaftler nahmen an, daß MS dann entsteht, wenn Myelin-spezifische T-Lymphozyten die körpereigene weiße Substanz des Nervensystems attackieren. Wahrscheinlich ist die Pathogenese aber viel komplizierter. Sie umfaßt außer pathogenen Faktoren im Bereich des Immunsystems zusätzliche Veränderungen im Nervensystem.
Das klinische Bild der Multiplen Sklerose ist durch entzündliche und degenerative Prozesse bestimmt, welche in umschriebenen, über das gesamte Nervensystem verstreuten Krankheitsherden ("Plaques") ablaufen. Der einzelne MS-Herd entsteht - vereinfacht dargestellt - in einem zweiphasigen Prozeß. In der ersten, entzündlichen Phase dringen aktivierte, Myelin-spezifische T-Lymphozyten durch die Blut-Hirn-Schranke in das Nervensystem ein. Sie regen örtliche Gliazellen zur Produktion von Immunmolekülen (z.B. MHC-Molekülen) an und schaffen somit die Voraussetzungen für die autoimmunogene Präsentation von Myelinproteinen. Deren Erkennung durch die T-Lymphozyten setzt eine Kaskade entzündlicher Reaktionen in Gang, welche in der Bildung typischer, um Gefäße gelagerter Rundzellinfiltrate und in örtlicher Ödembildung gipfelt. Die Lokalisation der Herde ist allerdings nicht zufällig: Immunzellen steuern bevorzugt pathologisch veränderte Gewebsareale an, also Gebiete, in denen infektiöse oder degenerative Veränderungen stattgefunden haben.
Zerstörung der Myelinsubstanz
Die eindrucksvollste und folgenreichste Veränderung des MS-Herdes ist die Entmarkungs- und Vernarbungsreaktion (daher der Name "Sklerose"). Es handelt sich dabei um die Zerstörung der Myelinsubstanz sowie der Myelin-bildenden Zellen (der Oligodendrozyten), die in einer zweiten Phase der Plaqueentstehung erfolgt. T-Lymphozyten sind für Entzündungs-, nicht aber für Entmarkungsreaktionen verantwortlich. Die Myelinzerstörung scheint vielmehr durch B-Lymphozyten, beziehungsweise durch deren Produkt, die Myelin-spezifischen Autoantikörper, bewirkt zu werden. Im Vordergrund stehen Autoantikörper, die das Myelin-Oligoden-drozyten-Glykoprotein (MOG) erkennen, das zwar nur einen geringen Anteil an den Myelinproteinen ausmacht (weniger als 0,1 %), aber durch seine Lage an der Oberfläche der Myelinscheiden eine Sonderstellung einnimmt.
Die hier dargestellten Forschungsergebnisse über die Immunreaktivität im Nervensystem wurden auf der einen Seite ermöglicht durch neuentwickelte Versuchsansätze, die immunologische Methoden mit solchen der Neuro- und Molekularbiologie kombinierten (z.B. bei der Klonierung und gentechnologischen Markierung autoimmuner T-Lymphozyten), und auf der anderen Seite durch neue elektrophysiologische Technologien wie etwa das Patch-Clamp-Verfahren. Für die Wissenschaftler stellt sich nun die Aufgabe, die neu gewonnenen Erkenntnisse klinisch anwendbar zu machen. Dies gilt nach Wekerle besonders für die Nutzung gentechnologischer Strategien bei der Entwicklung von Therapien entzündlicher und degenerativer Erkrankungen des Nervensystems.
Preisträger 1998
Prof. Konrad Sandhoff, 1938 in Berlin geboren, studierte Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), wurde dort 1965 mit einer Arbeit promoviert, die er am Max-Planck-Institut für Psychiatrie bei Prof. Horst Jatzkewitz angefertigt hatte, und habilitierte sich 1972 ebenfalls an der LMU. Bis 1979 forschte er - unterbrochen von Gastaufenthalten an der Johns Hopkins University, Baltimore/USA (1972-1974) und am Weizman Institute in Rehovot/Israel (1976) - am MPI für Psychiatrie in München. 1979 wurde er außerplanmäßiger Professor an der Universiät München und im gleichen Jahr erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor für Biochemie an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, an der er seither arbeitet.Von 1992 bis 1994 war er Dekan und von 1994 bis 1996 Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät dieser Universität. Sandhoff, der 1992 zum Fachgutachter für Biochemie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewählt wurde, hat viele wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten, darunter die Carl-Duisberg-Medaille der Gesellschaft Deutscher Chemiker (1976), den Heinrich-Wieland-Preis (1979) und die Richard-Kuhn-Medaille der Gesellschaft Deutscher Chemiker (1992). Seit 1992 ist er Honorary Member of the American Society for Biochemistry and Molecular Biology und 1996 hielt er die "Ranwell Caputto Lecture of the Argentine Society for Neurochemistry" in Cordoba.
Die Annahme des Zülch-Preises ist mit der Verpflichtung verbunden, im Rahmen der Preisverleihung einen Vortrag über die mit dem Preis ausgezeichneten Forschungsarbeiten zu halten. Prof. Konrad Sandhoff referierte am 25. September 1998 über das Thema "Neurodegenerative Erkrankungen als Folge von Defekten im Sphingolipidstoffwechsel". Zu den erblichen Stoffwechselerkrankungen, die das zentrale Nervensystem befallen - zum Teil in Kombination mit den peripheren Nerven und anderen Organen -, gehören viele seltene neurologische Krankheiten, die in der Regel autosomal-rezessiv vererbt werden. Klinisch unterscheidet man angeborene sowie im Kindes-, Jugendlichen- und Erwachsenenalter auftretende Krankheitsformen. Im Verlauf dieser Stoffwechselerkrankungen treten Speicherprodukte in Nervenzellen (und zum Teil auch in Gliazellen oder in anderen Organen) auf, die im Gehirn zu leichten, später gravierenden, stets aber irreversiblen und fortschreitenden Störungen führen. Die Aufklärung von Erbkrankheiten ist meist mühsam und langwierig. Nur für etwa 400 der mehr als 6000 beschriebenen Erbleiden, bei denen bereits ein Gen-Locus identifiziert wurde, sind die molekularen Ursachen heute aufgeklärt.
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten von Prof. Konrad Sandhoff steht eine Gruppe oft tödlich verlaufender Erbkrankheiten, deren molekulare Ursachen zunächst nicht bekannt waren: Im Rahmen seiner Doktorarbeit im Laboratorium von Prof. Horst Jatzkewitz am Münchener Max-Planck-Institut für Psychiatrie analysierte Sandhoff Mitte der sechziger Jahre postmortales Hirngewebe von Tay-Sachs-Kranken. Das klinische Bild dieser infantilen amaurotischen (mit Erblindung einhergehenden) Idiotie war erstmals 1881 von dem britischen Augenarzt Warren Tay beschrieben worden: Bei den daran erkrankten Kindern kommt es zu einer psychomotorischen Retardierung, vermindertem Blutdruck, Spastik, Krämpfen und einer Decerebration ("Enthirnung") mit schließlich vollständiger Blindheit. Der amerikanische Neurologe Bernhard Sachs beobachtete wenige Jahre später in den Hirnen von Patienten, die an diesem Leiden verstorben waren, aufgeblähte ("ballonierte") Nervenzellen.
Abgelagerte Speichersubstanzen
Ein halbes Jahrhundert danach entdeckte Ernst Klenk in solchen krankhaft veränderten Nervenzellen eine neue Gruppe von Sphingolipiden, die er Ganglioside nannte. Wie elektronenmikroskopische Untersuchungen des Amerikaners J.F.Terry aus den sechziger Jahren zeigten, werden die Speichersubstanzen in pathologisch veränderten Bereichen (Lysosomen) der Nervenzellen abgelagert. Die erste Klärung einer Gangliosidstruktur durch Kuhn und Wiegandt eröffnete schließlich 1963 den Weg für strukturchemische, enzymatische und pathobiochemische Analysen.
Sandhoff fand bei seinen Untersuchungen weitere Ganglioside, die im Hirn verstorbener Patienten aufgrund eines Abbaudefektes als Speichersubstanzen akkumuliert waren. Anhand der verschiedenen Speichermuster konnte er mehrere erbliche Krankheitsformen unterscheiden. All diesen Speicherkrankheiten oder Gangliosidosen ist ein fortschreitender, zumeist tödlich verlaufender Untergang von Nervenzellen gemeinsam. Die Struktur der Speichersubstanzen bei einer dieser neu entdeckten Krankheitsformen führte schließlich zur Identifizierung der defekten Enzyme, die normalerweise die Lipide abbauen. Durch die genaue Analyse der einzelnen Schritte bei diesem Gangliosidabbau gelang es Sandhoff, andere Lipidspeicherkrankheiten (von denen eine seit 1971 den Namen "Sandhoff disease" trägt) auf molekularer Ebene aufzuklären. Die Identifizierung der beteiligten Proteine gestattet heute eine frühzeitige pränatale Diagnose und bildet den Ausgangspunkt zum Studium von therapeutischen Möglichkeiten.
Im Verlauf der Sandhoffschen Arbeiten konnten neue biochemische Prinzipien erhellt werden: Sphingolipide der Zelloberfläche gelangen über Membranvesikel zunächst in die sauren Reaktionsräume der Zellen, das heißt, in deren intrazelluläre "Mägen", die Lysosomen. In ihrem Inneren werden sie als Bausteine der kleinen Membranvesikel verdaut. An dieser Verdauung sind neben Enzymen auch Hilfsproteine beteiligt - Aktivatorproteine, die eine Wechselwirkung zwischen den unlöslichen, membranständigen Sphingolipiden und den wasserlöslichen, abbauenden Enzymen vermitteln. Auf diese Aktivatoren stießen Sandhoff und Mitarbeiter bei der Untersuchung eines Tay-Sachs-Patienten, bei dem kein Enzymdefekt nachzuweisen war: alle abbauenden Enzyme erwiesen sich als voll aktiv. Erst durch gründliche Analyse der Gewebe ließen sich schließlich Existenz und zugleich Defekt eines Aktivatorproteins aufdecken.
Molekulare Defekte
Heute stellt die Erforschung der Enzyme und Aktivatorproteine des Gangliosidstoffwechsels einen Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Sandhoff an der Universität Bonn dar. Dem Team gelang es, verschiedene dieser Enzyme und Aktivatoren zu reinigen und sie anschließend auf Funktions-, Protein- und Genebene zu analysieren. Ein Ergebnis war dabei die Aufdeckung molekularer Defekte als Pathogenesegrundlage der seltenen, zu den lysosomalen Speicherkrankheiten gehörenden Lipidosen. Im Rahmen dieser Arbeiten konnte aber auch eine Reihe von ebenfalls sehr seltenen Stoffwechselstörungen als Aktivatorprotein-Mangelkrankheit aufgeklärt werden. Aktivatoren greifen aufgrund ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften zwar Sphingolipide der zu verdauenden Vesikel im Inneren der Lysosomen an, offensichtlich aber nicht die Bausteine der die Lysosomen begrenzenden Membran. Damit ist ein erster Schritt zur Beantwortung der Frage gelungen, warum sich Lysosomen nicht selbst verdauen, obwohl ihre begrenzende Membran im Prinzip aus ähnlichen Bausteinen besteht wie die der in ihrem Inneren abzubauenden Vesikel.
Aufgrund eines von Sandhoff und Mitarbeitern aus theoretischen Überlegungen abgeleiteten, einfachen kinetischen Modells ist zu vermuten, daß das Auftreten verschiedener - infantiler, juveniler und adulter - klinischer Verlaufsformen einer Speicherkrankheit auf unterschiedliche Restaktivitäten des jeweiligen defekten Enzyms zurückzuführen ist. Nach diesem Modell müßte es für eine Therapie oft ausreichen, in den erkrankten Geweben wieder etwa 10 bis 20% des normalen Enzymspiegels herzustellen. Therapeutische Versuche (Enzymersatz, Knochenmarkstransplantationen) an geeigneten Mausmodellen für Lipidosen - sogenannten knock-out Mäusen - haben bislang allerdings nur zu Teilerfolgen geführt: Sie bauten zwar ausreichende Enzymspiegel in den betroffenen Organen auf, nicht aber im erkrankten Gehirn, da die Blut-Hirn-Schranke weder für die Enzymproteine noch für Knochenmarkszellen in ausreichendem Maße durchgängig ist. Betroffenen Familien kann daher heute außer einer pränatalen Diagnostik keine Hilfe angeboten werden. Die Auslotung von Therapiemöglichkeiten wird aber - vor allem in Kooperation mit in- und ausländischen Arbeitskreisen - weiterhin intensiv vorangetrieben.
Prof. Wilhelm Stoffel, 1928 in Köln geboren, studierte Medizin an der Universität seiner Geburtsstadt, wurde 1952 - nach einem Forschungsaufenthalt am Institut für Biochemie der Universität Uppsala/Schweden - in Köln zum Dr. med. promoviert und begann danach an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ein Chemiestudium, das er 1957 an der Universität Stockholm mit einem Diplom abschloß. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Rockefeller University New York/USA (1957-1959) wurde der diplomierte Chemiker 1959 zum Dr. rer.nat. promoviert. 1959/60 war er - finanziert mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft - als Postdoktorand am Institut für Biochemie der ETH Zürich tätig. 1962 habilitierte er sich im Fach Biochemie an der Universität zu Köln und 1967 wurde er auf den Lehrstuhl für Biochemie der Medizinischen Fakultät dieser Universität berufen. Zwischen 1992 und 1995 gründete er an der Universität zu Köln das erste Deutsche Zentrum für Molekulare Medizin. Prof. Stoffel ist Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Akademien und Fachgesellschaften sowie Träger vieler wissenschaftlicher Auszeichnungen, darunter des Heinrich Wieland-Preises (1965), der Otto-Warburg-Medaille (1978), des Ernst-Jung-Preises (1990) und des Max-Planck-Forschungspreises (1992). 1993/94 erhielt er die Fogarty Scholarship des National Institute of Health der USA, 1994 den Ehrendoktor der medizinischen Fachschaft der Universität Hamburg.
Prof. Wilhelm Stoffel referierte im Anschluß an die Verleihung des Zülch-Preises am 25. September 1998 in Köln über das Thema "Von Proteinen und komplexen Lipiden zur molekularen Pathogenese neurologischer Krankheiten". Stoffel hat in seinem langen Forscherleben organische Chemie, Biochemie, Molekularbiologie und molekulare Genetik in den Dienst der neurobiologischen und neuropathologischen Grundlagenforschung gestellt. Einer seiner Schwerpunkte betrifft die Struktur-Funktions-Beziehung der Bausteine, aus denen die Markscheiden des zentralen Nervensystems (ZNS) und des peripheren Nervensystems (PNS) gebildet werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Markscheiden, die als Isolierschichten das Axon (den Achsenzylinder) der Nervenzellen umhüllen, ist das Myelin - ein komplexes Gemisch von fettähnlichen Substanzen (Phospholipide, Cholesterin u.a.m.) und Proteinen.
Markscheiden der Nervenfasern des zentralen und des peripheren Nervensystems treten erst spät in der Evolution auf. Von den Oligodendrogliazellen im ZNS und der Schwannzelle im PNS werden sie in der für die Hirnentwicklung wichtigen frühen Myelinisierungsphase gebildet. Markscheiden sind aufgebaut aus einem spiralig angeordneten, dicht gepackten, vielschichtigen Membransystem. Nur im Bereich der sogenannten Ranvierschen Schnürringe - Einschnürungen im Abstand von jeweils etwa einem Millimeter - ist diese Isolierschicht unterbrochen. Die Erregungsleitung erfolgt sprunghaft (saltatorisch) von Schnürring zu Schnürring mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 m/s und damit um ein Vielfaches höher als in nicht myelinisierten Axonen. Wegen dieses enormen Leitungstempos ermöglichen die Markscheiden eine starke Reduzierung des Axon-Durchmessers, was wiederum die Grundlage für die Miniaturisierung (das geringe Volumen) des ZNS ist. Die Markscheidenisolierung bringt aber noch einen weiteren Vorteil mit sich: Die Depolarisierung - die Aufhebung des elektrischen Potentials einer Nervenzelle - erfolgt nur im Bereich der Ranvierschen Schnürringe. Damit wird der Energieverbrauch zur Repolarisierung in diesen kleinen Membranbereichen erheblich reduziert.
Durch Strukturaufklärung der wesentlichen, am Aufbau der Markscheiden beteiligten Proteine - vor allem des integralen Membranproteins PLP (Proteolipidprotein) und des Enzyms CGT (Ceramidgalaktosyltransferase), des Schlüsselenzyms bei der Biosynthese der wichtigsten myelinspezifischen komplexen Lipide und Sphingolipide - gelang es Stoffel und Mitarbeitern, die Struktur-Funktions-Beziehung dieser für die Eigenschaften der Myelinmembran maßgeblichsten Bausteine zu entschlüsseln. Damit konnten erstmals molekulare Mechanismen von bestimmten - "Dysmyelinosen" genannten - Erkrankungen der Markscheiden des menschlichen zentralen Nervensystems aufgeklärt werden. Außerdem machte die proteinchemische Strukturbestimmung des PLP den Weg frei für molekulargenetische Arbeiten.
Gene Targeting-Technik
Auch auf diesem Gebiet stellten sich bald Erfolge ein: In Stoffels Laboratorium konnte das PLP-Gen des Menschen und der Maus charakterisiert werden. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, mit Hilfe der äußerst wirkungsvollen und faszinierenden Technik des "Gene Targetings" in Mäusen entweder das PLP-Gen auszuschalten (knock-out Maus) oder es durch ein mutiertes Gen zu ersetzen. So konnten je nach Fragestellung ganz gezielte Veränderungen des genetischen Locus im Genom der Maus vorgenommen werden, um auf diesem Weg molekulare Strukturen und deren Funktionen bzw. Dysfunktionen, den Phänotyp sowie letztlich die Symptomatologie von ZNS-Erkrankungen verstehen zu lernen, um sie zu diagnostizieren und verhindern bzw. therapieren zu können. Ein Ergebnis solcher in vivo-Experimente mit knock-out Mäusen war die Funktionsbestimmung des PLP: Es wirkt als Adhäsionsmolekül und hält die Myelinmembranen dicht gepackt zusammen, das heißt, es ist für die kompakte und stabile multilamelläre Struktur der Markscheiden verantwortlich. Der Verlust des PLP in der Myelinmembran reduziert die Geschwindigkeit der Erregungsleitung - was den entscheidenden evolutionären Vorteil myelinisierter Axone gegenüber nichtmyelinisierten unterstreicht.
Im menschlichen Genom liegt der PLP-Gen-Locus auf dem X-Chromosom. Die an das X-Chromosom gebundenen Erkrankungen der Markscheiden (Dysmyelinosen vom Typ der Pelizaeus-Merzbacher Krankheit) sind, wie Stoffel und Mitarbeiter zeigen konnten, auf Mutationen im kodierenden und/oder regulatorischen Bereich des PLP-Gen-Locus und auf dadurch hervorgerufene Fehlfaltungen des Proteins zurückzuführen. Die Pelizaeus-Merzbacher-Krankheit, die mit einem fortschreitenden Markscheidenuntergang einhergeht, ist eine sehr seltene Erkrankung bei männlichen Säuglingen oder Kleinkindern mit rezessiv-geschlechtsgebundenem Erbgang. Die Symptome sind Ganzkörpertremor, Krämpfe, Lähmungen, Erblindung und früher Tod. Die Tragweite der molekulargenetischen Analyse für die Prognose von Nachkommen heterozygoter weiblicher Trägerinnen einer Mutation des im X-Chromosom lokalisierten PLP-Locus ist, so Stoffel, "für deren Familienplanung evident". Im Labor von Stoffel wurde durch Aufklärung der Protein- und Genstruktur des PLP erstmalig eine humangenetische Beratung für diese Erbkrankheit auf molekularer Ebene ermöglicht.
Neue Strategie
Die neue Strategie des Gene Targeting zur Analyse von Struktur und Funktion wichtiger Moleküle des ZNS wurde schließlich von Stoffel und Mitarbeitern auch auf das Schlüsselenzym der Biosynthese wichtiger myelinspezifischer Lipide, das CGT, angewandt: Durch Ausschalten des CGT-Gens in der Maus wurde ein "cgt-/-Null-Maus-Modell" erstellt. Die homozygoten Tiere wiesen eine schwere Dysmyelinose auf, die nach drei bis fünf Wochen zum Tode führte. Biophysikalische Messungen an diesem Modell erbrachten den Beweis, daß die morphologisch intakt erscheinende, dicht gepackte Markscheide peripherer Nervenfasern völlig ionendurchlässig ist (was zu einem Schwinden der normalen saltatorischen Erregungsleitung führt) und daß darüber hinaus die Markscheiden des zentralen Nervensystems desorientierte Strukturen ausbilden, die den Kontakt zum Axon verloren haben. Die cgt-/-Null-Maus stellt somit eine neue, bisher noch nicht beschriebene Dysmyelinose mit frühem letalen Ausgang dar. Sie dürfte zur weiteren Aufklärung der kausalen und formalen Molekularpathogenese bei bislang noch ungeklärten pädiatrischen neurologischen Erkrankungen mit strukturellen oder funktionellen Myelinstörungen beitragen.
Die wenigen Beispiele aus einer Vielzahl von Maus-Modellen menschlicher Krankheiten sowohl des ZNS als auch des Stoffwechsels, die jetzt ohne Schwierigkeiten in Stoffels Laboratorium erstellt werden können, zeigen die Möglichkeiten auf, die sich heute durch Kombination von Biochemie, Molekularbiologie und molekularer Gentechnik eröffnen. Die Gene Targeting-Strategie erlaubt es, experimentell in das Neuland der normalen und pathologischen makromolekularen Hirnstrukturen und deren Funktionen vorzustoßen. "Mit dieser - und der mit noch höherem Sophistikationsgrad versehenen, zellspezifisch und zeitlich geregelten - Genausschaltung im Mausmodell", so schließt Stoffel, "ist dem auf der molekularen Ebene forschenden Neurobiologen ein vor wenigen Jahren noch nicht erahntes experimentelles Potential in die Hand gelegt. Unsere Experimentierkunst in dem Bemühen, neurologische Krankheiten molekularpathologisch zu verstehen und damit hoffentlich auch molekulare Ansätze zur Therapie aufzudecken, ist grenzenlos."
Preisträger 1997
Prof. Stanley Prusiner, 1942 in Des Moine, Iowa/USA geboren, studierte Medizin an der University of Pennsylvania in Philadelphia und wurde dort 1968 promoviert. Seinen Militärdienst absolvierte er am Laboratorium für Biochemie des National Heart and Lung Institutes in Bethesda/Maryland, danach ging er an die University of California, School of Medicine, in San Francisco. Seit 1980 ist er dort Professor für Neurologie, 1983 kam eine Professur für Virologie an der School of Public Health der University of California in Berkeley hinzu, und seit 1988 ist er außerdem Professor für Biochemie in San Francisco. Prusiner hat viele nationale und internationale Ehrungen und wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten, darunter - um nur einige zu nennen - in Deutschland den Max-Planck-Forschungspreis (1992) und den Paul-Ehrlich und Ludwig-Darmstaedter-Preis (1995), in den USA den Albert-Lasker-Preis für medizinische Grundlagenforschung (1994), in Israel den Wolf-Preis in Medizin (1996) und in Frankreich den Charles-Léopold-Mayer-Preis der Academie des Sciences (1996). Er ist Mitglied zahlreicher Akademien und wissenschaftlicher Gesellschaften sowie Mitherausgeber mehrerer renommierter Fachzeitschriften.
Die Annahme des Zülch-Preises ist mit der Verpflichtung verbunden, im Rahmen der Preisverleihung einen Vortrag über die mit dem Preis ausgezeichneten Forschungsarbeiten zu halten. Prof. Prusiner referierte am 26. September 1997 über das Thema „Prionen und Rinderwahn - die Geschichte eines Pathogenesekonzepts zwischen Ketzerei und Dogma ("Prions and Mad Cows - Embracing Fatal Conformations of Proteins during a Journey from Heresy to Orthodoxy"). Als Prusiner 1984 die Hypothese aufstellte, daß die Erreger bestimmter degenerativer Krankheiten des Zentralnervensystems (ZNS) bei Tieren - und seltener auch beim Menschen - ausschließlich aus einem pathologischen Protein bestehen, war die Skepsis der Wissenschaftler groß. Die Prion-Hypothese wurde als Ketzerei angesehen, denn die klassische biomedizinische Lehre besagte, daß übertragbare Krankheiten auf nukleinsäurehaltige Erreger wie Viren, Bakterien oder Protozoen zurückzuführen sind, das heißt der Transport solcher Krankeiten genetisches Material, nämlich Nukleinsäuren (DNA oder RNA), benötige, um eine Infektion in dem Wirtsorganismus auszulösen.
Weiteren Widerstand rief Prusiner hervor, als er die Vermutung äußerte, daß sich die Protein-artigen infektiösen Partikel, die er "Prionen" nannte, gleichermaßen bei übertragbaren wie vererbbaren Krankheiten finden würden - ein solches dualistisches Verhalten war bis dahin unbekannt -, und daß sich Prionen zudem auf eine schwer vorstellbare Weise vervielfältigen: sie wandeln normale Protein-Moleküle in gefährliche um, indem sie die gutartigen Moleküle veranlassen, ihre Gestalt zu verändern. Inzwischen sprechen allerdings viele experimentelle und klinische Daten dafür, daß die Prionen-Hypothese in allen hier erwähnten Bereichen korrekt ist. Prionen sind verantwortlich für übertragbare und vererbte Erkrankungen des ZNS, können aber auch sporadische Erkrankungen hervorrufen, an denen weder eine infektiöse noch eine erbliche Komponente beteiligt ist.
Die inzwischen bekannten Prion-Krankheiten mit tödlichem Ausgang werden neuropathologisch als "spongiforme Encephalopathien" charakterisiert. Im Tierreich sind sie relativ weit verbreitet: Die häufigste ist Scrapie, die Traber-Krankheit bei Schafen und Ziegen, dazu kommt der seit 1986 bekannte Rinderwahn (BSE), der nach Verfütterung von Fleisch- und Knochenmehl toter Schafe epidemische Ausmaße in Großbritannien annahm. Andere Prion-Erkrankungen bei Tieren sind die übertragbare Gehirnerkrankung bei Nerzen, chronische ZNS-Erkrankungen bei Elch und Rentier sowie die spongiforme Katzen-Encephalopathie.
Menschliche Prion-Erkrankungen sind im Vergleich zu tierischen seltener und obskurer. Etwa die Kuru-Krankheit, die nur unter der Urbevölkerung auf Papua-Neuguinea beobachtet wurde und auf einem rituellen Kannibalismus beruht, bei dem u.a. auch Hirn verspeist wird. Nachdem diese rituellen Exerzitien gestoppt wurden, ist die Krankheit völlig verschwunden. Die Creutzfeld-Jakob-Krankheit dagegen wird weltweit registriert. Sie entsteht meist sporadisch (10 - 15 % sind erblich) und führt mit Demenz zum Tod. In England trat 1996 eine bisher unbekannte Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit auf, an der zehn jüngere Menschen starben. Das ungewöhnlich junge Alter der Patienten - normalerweise tritt das Leiden erst jenseits des 60. Lebensjahres auf - und die besondere Art der spongiformen Encephalopathie führten zu dem Verdacht, daß möglicherweise der Verzehr von Fleisch BSE-infizierter Rinder als Krankheitsursache in Frage komme.
In den letzten Jahren sind zwei weitere menschliche Erkrankungen als von Prionen verursacht identifiziert worden: die dominant vererbbare Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Krankheit mit ihren Hauptsymptomen Ataxie (Störung des Bewegungsablaufs) und Anzeichen einer Kleinhirnzerstörung sowie die tödliche familiäre Schlaflosigkeit, die ebenfalls erblich ist und - wie ihr Name andeutet - in bestimmten Familien gehäuft auftritt. Prusiner vermutet, daß es weitere Prionen gibt, die aus anderen Proteinen bestehen und Ursache anderer, beim Menschen auftretender neurodegenerativer Krankheiten sein könnten.
Prof. Charles Weissmann wurde 1931 in Zürich geboren, wuchs in Zürich und Rio de Janeiro auf, studierte an der Universität Zürich und wurde dort 1956 in Medizin und 1962 in Organischer Chemie promoviert. Anschließend arbeitete er sechs Jahre lang am Department für Biochemie der New York University, School of Medicine. 1967 wurde er Extraordinarius und drei Jahre später Ordinarius für Molekularbiologie an der Universität Zürich. Auch Weissmann erhielt viele hohe wissenschaftliche Auszeichnungen und Ehrungen, darunter in Deutschland den Ernst-Jung-Preis für Medizin (1988), die Robert-Koch-Medaille (1995) sowie die August-Wilhelm von Hofmann-Denkmünze der Gesellschaft Deutscher Chemiker (1997) und in Frankreich - gemeinsam mit Stanley Prusiner - den Charles-Léopold-Mayer-Preis der Academie des Sciences (1996). Weissmann ist Mitglied zahlreicher Akademien - darunter der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina - und wissenschaftlicher Gesellschaften sowie Mitherausgeber namhafter Zeitschriften.
Charles Weissmann referierte über "Die Rolle des 'Prion-Proteins' in degenerativen Erkrankungen des Zentralnervensystems". Die normale Form dieses Eiweißes kommt in allen höheren Organismen vor, und zwar vor allem im Hirn. Es wird vermutet, daß dieses normale Protein, wenn es mit der (von außen eingeführten) abnormen Form in Kontakt kommt, ebenfalls in die abnorme Form überführt wird. Durch diesen Vorgang wird der Krankheitsprozeß eingeleitet und der Erreger kaskadenartig vermehrt.
Die essentielle Rolle des normalen Prions bei der Genese der Krankheit wurde von Weissmann mit Hilfe gentechnisch veränderter Mäuse nachgewiesen. Mäuse, deren Gen für die Erzeugung des normalen Prions inaktiviert war und die deshalb dieses normale Prion nicht ausbilden konnten, erwiesen sich überraschenderweise als völlig resistent gegen die Traberkrankheit Scrapie und vermehren dessen Erreger nicht mehr. Erst wenn man in diese Mäuse das entsprechende Gen wieder einführte, kehrte die Anfälligkeit für Scrapie zurück. Aber nicht nur die Vermehrung des Erregers, sondern auch sein Transport durch den Organismus hängt von der Existenz des normalen Prions ab, d. h. er wird nicht durch Blut oder Lymphe transportiert. Am Schluß geht Weissmann noch auf einen interessanten Aspekt ein: Da die Mäuse, deren Gen für das normale Prion-Protein inaktiviert war, keinerlei Entwicklungs- oder Verhaltensstörungen zeigten, eröffnet sich hier möglicherweise die Aussicht, Schafe oder Rinder zu züchten, die kein normales Prion-Protein ausbilden können und deshalb resistent gegen Traberkrankheit bzw. Rinderwahn sind.
Preisträger 1996
Prof. Dr. Konstantin-Alexander Hossmann, Max-Planck-Institut für neurologische Forschung, Köln: Systemische Pathophysiologie der Hirnischämie
Prof. Dr. Michael A. Moskowitz, Harvard Medical School, Boston, MA, USA: Molekulare Pathogenese der Hirnischämie
Preisträger 1995
Prof. Dr. Konrad Beyreuther, Universität Heidelberg: Pathogenese der Alzheimerschen Krankheit
Prof. Dr. Colin L. Masters, University of Melbourne, Australien: Molekulare Pathologie der Alzheimerschen Krankheit
Preisträger 1994
Prof. Dr. Wolf-Dieter Heiss, Max-Planck-Institut für neurologische Forschung, Köln: Positronen-Emissions-Tomographie neurologischer Erkrankungen
Prof. Dr. Wolf Singer, Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt: Organisation und Interaktion kortikaler Hirnfunktionen
Preisträger 1993
Prof. Dr. David Ingvar, Universität Lund, Schweden: Messung der regionalen Hirndurchblutung zur Lokalisierung menschlicher Gehirnfunktionen
Prof. Dr. Lindsay Symon, Institute of Neurology, London, U.K.: Experimentelle und klinische Pathophysiologie der zerebralen Ischämie
Preisträger 1992
Prof. Dr. Otto Creutzfeldt, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen: Neurophysiologie kognitiver Funktionen des Gehirns
Prof. Dr. Bo K. Siesjö, Universität Lund, Schweden: Molekulare Mechanismen der hypoglykämischen und ischämischen Hirnschädigung
Preisträger 1991
Prof. Dr. Paul Kleihues, Universität Zürich, Schweiz: Molekulare Neuroonkologie
Prof. Dr. Georg Kreutzberg, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München: Interaktion von Glia-und Nervenzellen
Preisträger 1990
Prof. Dr. Lars Olson, Karolinska Institute, Stockholm, Schweden: Transplantation von Nervengewebe zur Behandlung des Morbus Parkinson
Prof. Dr. Anders Björklund, Universität Lund, Schweden: Experimentelle Untersuchungen zur Behandlung neurologischer Erkrankungen durch Transplantion von Nervengewebe